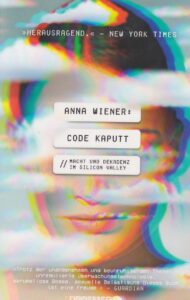
Droemer 2020 | 311 Seiten.
>> In ihrer sehr persönlich gehaltenen, autobiographischen Reportage weiht die junge New Yorkerin ihre Leserschaft in den real-virtuellen Intimbereich der Hightech-Physiognomie des Silicon Valley ein. Nach dem Studium der Literaturwissenschaften und ersten darbenden Berufserfahrungen im alternativen Milieu kleiner Ostküstenverlage folgt Anna Wiener dem Sog kalifornischer Versprechen. Mit selbstgestrickten IT-Grundkenntnissen findet sie Anschluss im kleinsten Start-up und schließlich Software Mega-Einhorn, dessen Milliardenveräußerung auch ihr ein ordentliches Vermögen beschert. Über mehrere Jahre kostet sie am toxischen Nektar dieser Früchte, berauscht sich an ihren Wirkungen und leidet unter den Nebenwirkungen. Am Ende mutet sie sich den Entzug zu, um sich schriftstellerisch verwirklichen zu können. Und dennoch weiß sie schon mit 33 Jahren, dass dieses Kalifornien die wertvollste Zeit ihres Lebens beschreiben wird. Vielleicht, weil es verstörend erhellend war und fortan ihre publizistische Kritikfähigkeit schärfte. Vielleicht auch, weil es Resonanzübereinstimmungen mit ihrem Ego gab, welches nach Anerkennung, Wissensbefriedigung und Wohlstand strebt. Etwas, was sie mit vielen teilt.
Durch die junge Gründerszene in der Bay Area wabert unentwegt eine Goldgräberstimmung. Abenteuerlust, der Traum von überschäumendem Wohlstand und Ruhestand mit 36 Jahren, Subversivität und Mediensuchtbefriedigung. Unbestritten geniale Produktideen treffen auf Risikokapitalgeber, deren gigantisches Finanzpolster unbeschadet 90% Verluste verkraftet. Das Gros der Hunderttausende ist keine 30. Spektakuläre Erfolgsgeschichten haben Minderjährige eingeleitet, so dass auch ein 28-jähriger Neumilliardär niemanden überrascht. Es sind die Millennials, Schulabbrecher genauso wie frühreife Eliteuniversitätsabsolventen, die sich „down to the cause“ 70/80 Stunden die Woche mit Begeisterung oder in brutaler Fremdbestimmung in den ihnen gestellten Aufgaben verlieren. Sie mobilisieren in einem Ausmaß Kräfte, wie es vermutlich nur in dieser Lebensphase möglich ist.
Die Arbeit, die sie leisten, zielt vor allem auf Finanzmittel und auf Macht. Die Lenkung des Einzelnen durch raffinierte Durchleuchtung der Massen. Es geht nicht um Kultur, Ethik, Gesellschaft oder Politik. Das von Anna Wiener beschriebene Segment instrumentalisiert Informationstechnologie: Codes und Algorithmen, die verwertbare Weisheit aus gigantischen Datavolumina von Konsumenten ziehen. Stets erfolgt die Meta-Einordnung der Arbeit kontextfrei. Der einfachste Weg, um sich aller Verantwortungen zu entziehen. Man arbeitet nur für den Auftraggeber. Ob er das Produkt missbraucht, liegt nicht in ihrem Ermessen. Als just in dem Moment Snowden als Whistleblower zum Staatsfeind erklärt wird, weil er Geheimdienstdaten veröffentlichte, antwortet die Analytics-Gemeinde mit eisernem Schweigen. Anna Wiener schreibt später: „Wir haben´s vergeigt“, und meint damit die kritische Reflexion.
Viele Start-ups zielen auf existente Märkte. Ziel ist, Reviere zu erobern, Platzhirsche zu verdrängen und gewinnbringende Abhängigkeiten zu schaffen. Das Schlüsselkonzept der Epoche heißt „Disruption“. Online-Händler verdrängen den Einzelhandel, Online-Couching bedroht die Reisebranche, Online-Fahrdienste gefährden das Transportwesen. Selten führt eine disrupted Ruine zu gemeinnützigen, nachhaltigen Innovationen wie Wikipedia. Meist mündet es im Hightech-Überlaufbecken, der Werbeindustrie. Hinter jedem dieser Ansätze steht eine Code Idee. Anna Wiener findet: die Balance zwischen Nutzen und Missbrauch ist schon lange gekippt. Code kaputt.
Zunächst betörend ist für sie das Milieu. Die Begeisterung in den kleinen Start-ups ist infektiös, Umgangsformen sind total entspannt, Selbstverwirklichung eines jeden ist garantiert. Mit dem Skateboard durch´s Büro, Drogendepot im Oval Office, Rave Parties auf dem Lande, Ski-Coming–outs in den Mountains, World Travelling ohne Grenzen. Selbst der Arbeitsplatz darf gerne permanent das Vacation Office sein. Ausgesprochene Bedingung ist jedoch der Hochleistungseinsatz, der weniger am Tun als vielmehr am Erfolg gemessen wird. Ohne diesen mutieren die jugendlichen CEOs zu Kettensägen. Bäume stürzen in die Lichtung. Mittlere Führungskräfte treten erhebliche Gehaltsanteile an Psychotherapeuten ab, um ihrer Angstträume Herr zu werden. Männer bleiben Männer, Arroganz und seelische Gewalt sind so selbstverständlich wie auch außerhalb des Ökosystems. Eine unfreiwillige Trennung von einem Start-up muss Anna Wiener verarbeiten, zwei weitere vollzieht sie in vier Jahren selbst.
Als Alternative bietet sich ihr eine expandierende Open-Source Firma. Gegenstand sind Codes, die unverschlüsselt allen zugänglich sind. Ein Solidarprodukt, das kollektiv optimiert und vielseitig applizierbar ist. Die Anhängerschaft wird als subversiv, gegenkulturell und tech-utopisch charakterisiert. Aber dann die Erkenntnis, dass die Algorithmen ebenso zu Suizid- und Bombenanleitungen missbraucht werden und dass auch dieser wie alle Ansätze der Widersprüchlichkeit des menschlichen Daseins verhaftet bleibt. Am Ende schluckt Microsoft für sieben Milliarden dieses konkurrierende Unternehmen, nachdem ein Prozesskrieg gegen die Open-Source Divisionen keine Landgewinne zeitigte. Und dann die Wahl von Trump, der die ausländischen Fachkräfte aussperrt. „CEOs und Risikokapitalgeber und Verzweiflungspatrioten mit treuhänderischen Verpflichtungen reichten den gewählten Amtsträgern Ölzweige … Hoaxing, Desinformation und Memes, lange Zeit die Insignien der Forenkultur, verlagerten sich in die bürgerlichen Sphären. Trollen wurde zu einer neuen politischen Währung.“
Silicon Valley – ein Epochen-Biotop. So klein wie ein kartoffelgroßes Schwarzes Loch aber mit einem Wirkungsradius bis in die Außenbezirke des Sonnensystems. Was dieses Buch so lesenswert macht, ist die gelungene Symbiose von Ich-Offenbarung, vom Sezieren der IT-Kultureingeweide, von Branchen-inherenten Philosophien und der soziologischen Dekonstruktion der unglaublich produktiven Youngsterbewegung. Beeindruckend auch Wieners literarische Inszenierung dank ausgewogener Subjektivität, die nicht mit Tränenbeuteln um sich wirft. Lesenswert. Note: 2+ (ur) <<
>>Die 25jährige Anna Wiener taucht nach einem „unsicheren aber angenehmen Leben“ in der wenig zukunftsfähigen Verlagsbranche in New York ein in die high-tech Welt von Big Data von Silicon Valley, in der hippe, smarte hochqualifizierte Mitzwanziger Start-ups gründen um in kürzester Zeit beim Big Money zu landen: „Ein nicht unerheblicher Anteil meiner ehemaligen Kollegen wurde zu Milliardären“ -es muss nicht gegendert werden!- lässt uns die Autorin im Schlusskapitel wissen. Es ist eine Welt, die fasziniert und zugleich verstört und gerade diese Ambivalenz aufzudecken, ist die Stärke von Anna Wieners Reportage. Das Buch gibt Einblicke in ein Business, dessen Strukturen letzten Ende verborgen bleiben. Entscheidend, ist das zu vermarktende Produkt, hier Software, erdnah oder in der Cloud. Vielleicht ist das der Frust, der mich bei der Lektüre zuweilen beschleicht und mich nach frischer Luft schnappen lässt, dass mir die Code-Welt, die Tools, die Datenbank- strukturen und der diversen Metriken, deren Ergebnisse ich täglich nutze, reichlich fremd und zuweilen unheimlich sind. Anna Wiener, die im Kundensupportbereich für Softwareentwickler arbeitet, bewegt sich durch dieses Milieu zwischen Identifikation und Distanz und gerade dadurch gelingt ihr eine überzeugende Innensicht der Branche, die einerseits Raum für technikaffine Individualisten mit z.T. ausgeprägten Spleens und Skurrilitäten bietet, sich aber anderseits einem klaren Ziel verpflichtet weiß :“Das höchste Ziel war für alle das Gleiche, und zwar Wachstum um jeden Preis, Skalierung über alles. Disrupten und herrschen“(155) DFTC – „mit Leib und Seele dabei“ das ist das Mantra nicht nur der CEOs und so werden fast alle menschlichen Beziehungen über Arbeitsbeziehungen definiert, Übergänge von Arbeit und Freizeit fließend, Lunchmeetings, Teambuildingevents, Videokonferenzen vom Poolliegestuhl aus, die Kategorie „Party“ sinnentleert, selbst der Kuscheltherapeut beim Rave im Sacramento-Delta erweist sich für die Bay Area als Optimierer. Überhaupt scheint diese Szene, die ja zuweilen auch noch einen schwachen Hauch von alternativer Lebensform atmet (barfuß, Gitarre,, Gras) dem Fetisch der Optimierungskultur verfallen. Als Begrüßungsgeschenk beim Open-Source-Start-up ein Schrittzähler-Armband signalisiert nur die simpelste Form der Selbstentmündigung. Die von der Autorin genannten „Produktivitäts-Hacks“ und das sog. „Biohacking“ sind die Spitze der Fremdsteuerung. Es scheint schlüssig, dass sich unsere Autorin nach 5 Jahren dieser Welt entzieht, ökonomisch einigermaßen abgesichert, keineswegs verbittert, sondern erfahrungsreich und selbstbewusst, um einen neuen kreativen Blick als Schriftstellerin von außen auf „das Gerüst, das System, das da am Werke war“ zu richten. Dass für die Autorin dieser Schritt „ein Weg aus dem Unglücklichsein“ ist, zeigt, dass die mitunter flott beschriebene Innensicht der Techwelt, doch Spuren in der Seele hinterlassen hat. Gut, dass da Jan nicht nur ein Robotik-Nerd ist. Die Danksagung verrät mehr als das Buch. Note : 2+ (ai) <<
>>Nach Leif Randts Allegro Pastell nun schon wieder ein Exkurs in eine Parallelgesellschaft: Die der Start- up-Szene und der Tech Branche im silicon valley, dem „unheimlichen Tal“, wie der autobiographische Roman Anna Wieners im amerikanischen Original heißt. Die Ich- Erzählerin Anna, ohne Zweifel die Autorin, lebt 2012, als facebook an die Börsen ging für über 100 Milliarden Dollar, noch mit einem Mitbewohner, den sie kaum kennt, am Rande von Brooklyn. Sie ist 25 Jahre alt, Soziologin, und in ihrem Job als Assistentin in einer Literaturagentur festgefahren, ohne Perspektive und Aufstiegschancen, eine „Privilegierte mit guten sozialen Abstiegschancen“. Ihr soziales Umfeld ist größtenteils analog unterwegs wie sie selbst. Das „Onlinekaufhaus“, wie Amazon im Buch nur genannt wird, hatte sich inzwischen allerdings schon zu einer Krake entwickelt, ohne die das Internet „praktisch nicht mehr nutzbar war“ und die die Verlagsbranche im Würgegriff hatte. Als Anna von einem E-Reader Start-up in New York liest, ist sie fasziniert von der Aufbruchstimmung, die die Gründer ausstrahlen, und bewirbt sich erfolgreich. Das Start-up war mit Millionen finanziert worden, hat aber nur 5 Mitarbeiter und die App ist noch gar nicht auf dem Markt. Der Nutzen der App, das wird Anna schnell klar, besteht weniger im Lesen, als vielmehr darin, sich selbst als jemand darzustellen, der liest. Die Zauberformel der Tech-Branche – ask forgiveness, not permission – also lieber um Verzeihung bitte, als um Erlaubnis, ist Anna noch völlig fremd. Sie muss bald wieder gehen. Die Gründer des start-up raten ihr, nach San Franciso zu gehen und geben ihr auch eine Empfehlung mit. Sie ist 25. Einige ihrer College Kollegen waren dort hingezogen, in ein SF der Hippies, Lesben und Schwule, Künstler und Aktivisten, der Entrechteten und Nichtangepassten. Inzwischen waren aber alle wieder weg. Denn bay area hatte sich in ein „spätkapitalistisches Schreckensszenario“ verwandelt. Die Mieten schossen in die Höhe, Galerien und Konzerthallen machten zu, Datingseiten wurden von milchgesichtigen Strebern überflutet. Anna bewirbt sich in SF um eine Kundensupport-Stelle in einem Datenanalyse -Start-up, gegründet von College Abbrechern, mit 12 Millionen Risiko Kapital ausgestattet und 17 Mitarbeitern. Die beiden Gründer sind 24 und 25. Das Start-up ging aus einem „Inkubator“ hervor, eine Art Kaderschmiede für Start-ups, die diesen gegen eine 7% – Beteiligung beim Start behilflich ist. Das Einstellungsgespräch erweist sich eher als Strafe, als eine Art schikanierendes Initiationsritual. Am Ende wird ihr aber noch überraschenderweise der Einstellungstest für ein Jura Studium vorgelegt, den sie mit Bravour besteht. Sie wird eingestellt. Sie verdient 65.000 Dollar. Ihre Freunde aus der Gegenkulturszene in New York stehen der Tech Branche sehr skeptisch gegenüber. In dieser Phase gibt es widersprüchliche Tendenzen bei Anna. Sie redet sich ein, nur einen Brotjob anzutreten, der ihr ermöglichen würde, weiterhin kreativ zu sein, andererseits ist sie neugierig auf ihr neues Leben, will dass ihr Leben endlich Fahrt aufnimmt. Es war eine Zeit, in der sich die Unternehmen bei den jungen Informatik Absolventen anbiederten, ihnen 100.000 Dollar Gehälter versprachen. „Den Programmieren folgten eine Flut nicht-technischer Goldgräber, ehemalige Doktoranden und Mitteschullehrer, Pflichtverteidiger und Kammersänger.“ Anna versucht sich in die technische Dokumentation der Analyse-Software einzuarbeiten und verfällt in Panik: „Ich hatte keine Ahnung, wie um alles in der Welt ich Entwicklern technischen Support leisten sollte“. Ihr Analyse Start-up verschaffte anderen Unternehmen durch ihr „tool“ maßgeschneiderte Daten über das gesamte Verhalten ihrer Kunden, ihr „engagement“ und das noch dazu in farbenfrohen, dynamischen „Dashboards“. Es verdrängt etablierte Big Data Unternehmen. Bei den Mitarbeitern herrscht eine sehr entspannte, unkonventionelle Atmosphäre und Anna erhält viel Unterstützung. Die Mitarbeiter im Kundensupport erhielten vollen Zugriff auf sämtliche Datenbanken der Kunden, den „God-Mode“. Auf diese Weise erhält Anna tiefe Einblicke in die Geschäfte der Szene. Das Start-Up vertraut naiverweise darauf, dass die Mitarbeiter dies nicht ausnützen würden. Es ist die Zeit, in der ein 13 Personen Foto-Sharing Start-Up- offensichtlich ist Instagram gemeint – von facebook- „ das soziale Netzwerk, das alle hassten“ für 1 Milliarde Dollar aufgekauft wird. Auch das Analyse start-up ist auf dem besten Weg ein „Einhorn“ , d.h. ein Unternehmen mit einer Milliarde Dollar Bewertung zu werden.
Anna zieht in ein winziges Apartement, für 1800$ pro Monat, in einer Gegend, die noch vom Geist der 60 er Hippijahre zehrte. Sie datet verschiedene Männer, obwohl sie sich mit Noah, der ihr als eine Art Mentor an die Seite gestellt wird, sehr gut versteht. Bei einem Softwarentwickler spürt sie nach einigen Treffen: Sie würde nicht in dessen „akribisch inszeniertes Leben“ passen. Schon die Vorstellung, ein öffentliches Bild oder eine individuelle Ästhetik von sich selbst zu kultivieren, wie es zunehmend viele Leute ihres Alters tun, findet sie anstrengend. Es ist die Zeit, als durch Edward Snowden bekannt wird, dass die NSA Menschen in unvorstellbarem Maße ausforscht. Inzwischen wächst das Analyse-Startup und Anna darf inzwischen selbst Einstellungsgespräche führen. Sie verliebt sich schließlich in Ian, den Mitbewohner von Noah. Ian arbeitet in einer Robotic Firma, die von Google aufgekauft wurde. Als Noah, einer der besten im Analyse Startup, ultimativ mehr Gehalt und Aktienoption verlangt, wird der prompt gefeuert. Auch Anna wird eines Tages völlig überraschend vom CEO nahegelegt zu kündigen. Sie will aber bleiben und wird sogar noch befördert. Als Customer-Success Managerin verdient sie jetzt mit ihren 26 Jahren 90 000 Dollar im Jahr.
Über eine Freundin erhält sie schließlich das Angebot eine start-up, das ein open-source Tool für Softwareentwickler herstellt und das mit 100 Millionen Risikokapital ausgestattet ist. Das Unternehmen ist nach dem Community Modell aufgebaut und folgte deren „subversivem, gegen-kulturellem und hochgradig tech-utopischen Ethos“. Anna fühlt sich wohl in dem Team und hat ein vernünftiges Gehalt mit sehr guten ´Zusatzleistungen. Schon bald erfährt sie jedoch von Skandalen um sexuelle Belästigung im Unternehmen und die Stimmung wird schlechter. Auch Trolle, Fake accounts und Hasskampagnen in den sozialen Medien machen dem start-up zu schaffen. Anna lässt sich vom Optimierungswahn der Mitarbeiter anstecken und versucht es mit Gehirndopingmitteln.
Als die Präsidentschaftswahlen anstehen, engagieren sich Anna und viele ihr Kolleginnen aus dem Startup im Wahlkampf gegen Trump. („This Pussy grabs back“). Nach dem Sieg Trumps macht sich Depression breit: “ Es sind keine Erwachsenen mehr im Weißen Haus“. Auch Anna fühlt sich ausgebrannt und verlässt Anfang 2018 das open source Unternehmen. Nur kurz später wird es von Microsoft aufgekauft. Dadurch werden etliche frühere Mitarbeiter von Anna zu Milliardären. Ihre eigenen Aktienoptionen sind 200.000 Dollar wert. Für sie sehr viel Geld.
Anna will schreiben, eine kreative Arbeit machen. Sie kann sich nicht mehr vorstellen, „noch einmal so gefällig zu sein und mich derart aufzehren zu lassen“.
Selten hat man so einen klug geschriebenen, sehr persönlichen Einblick in die fremdartige, zuweilen verstörende Welt der Techbranche erhalten. Note: 1/ 2 ( ün)<<
>> Von der Ost- an die Westküste und nach fünf Jahren retour. Zwei sehr unterschiedliche Welten. Anna Wiener lernt sie beide kennen. In New York als Assistentin in einer Literaturagentur, im Silicon Valley von San Francisco in der Kundenbetreuung, neudeutsch Support, von zwei IT-Firmen. Diese Tätigkeit füllt sie über die Jahre immer weniger aus. Der Leser*** erfährt viel über die Arbeitsbedingungen und die Unternehmenskultur von IT-Firmen, über die Denke der dort Beschäftigten, die so ganz anders ticken als als die Lebenszeitbeamten deutscher Bundesländer. Beeindruckend ist bei aller vordergründigen Lässigkeit die Forderung nach „Down for the cause“ (DFTC), die Hingabe für die Firma. Selbstoptimierung in all ihren Spielarten wird groß geschrieben. Breiten Raum nehmen die Kleidung, Essen und Trinken, Freizeitgewohnheiten der überwiegend jungen Männer ein. Mich interessiert das in dieser Fülle nur bedingt, vor allem, wenn ich dann noch nachschauen muss, was mit manchen Kleidungsstücken eigentlich gemeint ist. Die detaillierte Beschreibung männlicher Körper langweilt. Umgekehrt entstünde Sexismusverdacht. Corporate Identity entsteht und wird gepusht durch zahlreiche außerbetriebliche Freizeitveranstaltungen. Alles sehr cool, flache Hierarchien, aber die „Wärme im Team“ ist nur bedingt echt, wenn ein Mitarbeitergespräch damit endet, dass die Autorin zum Heulen aufs Klo rennt. Personeller Wechsel ist gang und gäbe, anders als in beamteten Arbeitsverhältnissen. Bundesverdienstkreuze für 50-jährige Betriebszugehörigkeit sind nicht vorgesehen. Anna Wiener gelingen viele ironische und gleichzeitig schöne Sätze, wenn sie etwa auf einer Tagung ein „Meer von Männern im Zaumzeug laminierter Tagestickets“ entdeckt oder von sich sagt: „Mein Hirn war zu einem Müllstrudel geworden.“ Man ahnt, was sich hinter dem Netzwerk verbirgt, „das alle hassten“.
Ein Glossar der überreich verwendeten Fachbegriffe und weniger Wiederholungen hätten die Lektüre erleichtert. Die Übersetzung des Originaltitels „Uncanny Valley“ mit „Code kaputt“ erschließt sich mir nicht.
„Pures Lesevergnügen“ lese ich im Netz. Na ja. Lohnend auf jeden Fall.
Note: 2/3 (ax)<<
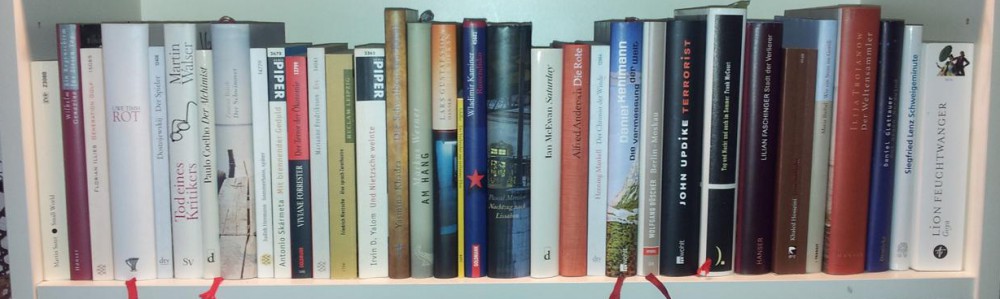
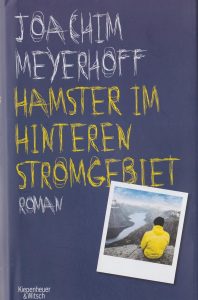
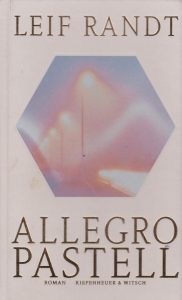
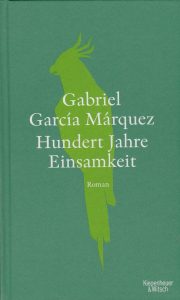
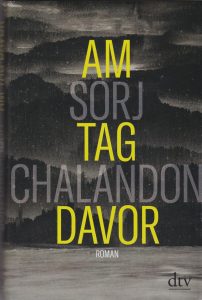
 rororo 92. Auflage 2020| 350 Seiten.
rororo 92. Auflage 2020| 350 Seiten.
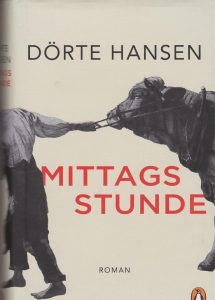 Penguin Verlag 2018 | 320 S.
Penguin Verlag 2018 | 320 S. C.H.Beck 2019 | 189 S.
C.H.Beck 2019 | 189 S. Kiepenheuer & Witsch 2018 | 198 Seiten.
Kiepenheuer & Witsch 2018 | 198 Seiten.