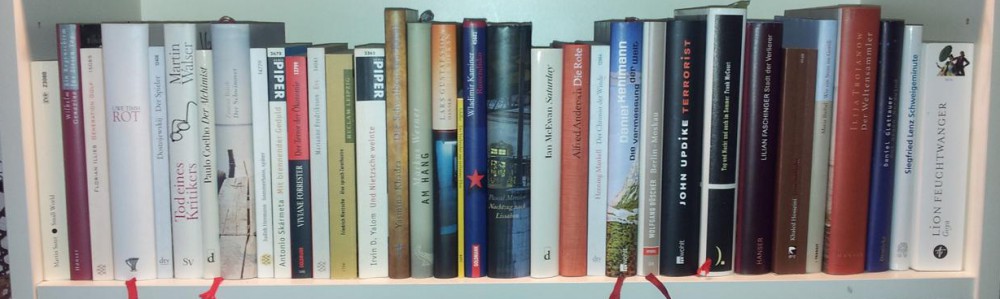Mattes&Seitz, 2024 | 235 Seiten.
Mattes&Seitz, 2024 | 235 Seiten.
<<Hannah erbt von der schon reichlich skurrilen und kaltherzigen Mutter einen Hühnerhof mit 300 Hühnern, darunter erstaunlich viele Einbein- und Einäugige. War die Mutter schon sehr schräg drauf, entwickelt auch Erbin Hannah eine innige, pathologisch überdrehte Beziehung zu den Hühnern und hat bald die brillante Idee, zu jedem Hähnchen, das sie auf dem Markt verkauft, eine Biografie mitzuliefern, was beim Publikum gut ankommt. So weit so gut. Was Hannah dann aber – in einem lakonischen Präsens erzählt – an Verrücktheiten abliefert, geht auf keine Kuh- sorry Hähnchenhaut.
So liebt sie den „strengen Geruch der Hühner mehr als Louis Liebesbekundigungen“. Louis ist ihr Mann , der noch in der Stadt wohnt und sie mit Fotos versorgt, damit sie masturbieren kann.
Für die Hühner wird ein Spielplatz mit Rutsche gebaut, sie dürfen auch mit fernsehen und mit ins Bett oder sie schlafen im Hundekörbchen. Die Hähnchen nennen sie „Menschenskinder“.
Hannah ist allerdings Vegetarierin und redet im Zusammenhang mit dem Verkauf der Hähnchen ständig und penetrant von „Leichenteilen“, von „Exekutionen“, „Todesurteilen“. Auch als ihr 4 fingriger Mann Louis nachts heimlich ein Stück Wurst isst, ekelt sich Hannah. “Ein obszöner Wurstgeruch geht von ihm aus“.
Am Ende eskaliert das ganze Unternehmen in einer absurden Gewaltorgie, als die Hähnchen mit Biografie in Massen an Supermärkte verkauft werden.
Ein recht plumpes und ärgerliches Plädoyer gegen den Verzehr von Hähnchenfleisch, frei von jeglicher Logik und ohne Witz. Note: 5 ( ün) <<
>> Ja, ein roter Faden zieht sich durch die Geschichte der 36jährigen Hannah, doch diese Blutspur ist voller Ungereimtheiten, nicht nur das Genre Ballade betreffend. Ein reichlich schräges Theodore-Vermächtnis der Mutter macht die Vegetarierin, die kein Fleisch mehr essen und kein Hühnchen mehr schlachten kann, binnen kurzem zur Hühnchenvertrauten. Um den „strengen Geruch“ des Federviehs „mehr zu lieben“ als „die Liebesbekundungen“ ihres Ehemanns Louis, bedarf es allerdings einer kühnen Verwandlung des Tiers zum „Menschenkind“. Der Hühnerhof im Dorf ihrer Kindheit wird zum Ort liebevoller Zuwendung mit gelegentlicher Einzelbetreuung. Eine exklusive Minibiografie ziert jede Vakuumverpackung. Das einzelne Huhn wird posthum zur „Persönlichkeit“. So sehr es in der Hühnerschaar von 300 auch menschelt, Hannahs lustvoll praktizierte Exekutionsformen wie Halsumdrehen, Messersticke, Beil machen aus der Überhöhung und Individualisierung das Tier zur Ware. Dass mit dem Auftritt Fernand Rabatet eine ganz neue Form der Vermarktung und Kommerzialisierung beginnt, lässt schon ahnen, dass uns kein Happy-end erwartet. Der Vertrag, der Hannah zur Komplizin im Tierhandel großen Stils macht, erfährt – ethisch abgesichert – letztlich auch die Zustimmung der Hühner. Jetzt brechen alle Dämme. Der Hühnerstall wird zur Fleischfabrik . Mehrgeschossige Lebenshalle, Leichenhalle, Observatorium (Beobachtungsposten) aus weißem Beton. Entworfen von Louis , Ehemann und Architekt, dessen eigentliches Arbeitsgebiet: Projektplanung für Abu Dhabi (!!) Das Interieur Kunstrasen, Puppenhäuser, Spielgeräte, Kunsthimmel mit „ewigem Frühling“. Platz für 10.000 Hühner. Dass Hannah hier „eine Armee von untoten Hühnern unter einem Antihimmel, zum Angriff bereit“, vorfindet, ändert zunächst nichts an der Illusion einer persönlichen Mensch-Tier Beziehung. Als kleiner Ausflug in die Abteilung „Slapstick“ dienen Lyriklesungen für Hühner, die Kochtopf-Exekution des Sohnersatzes Aval oder etwas umfangreicher die Rekrutierungsepisode der neu einzustellenden Texter. Dass Hannah schlussendlich erst ein Licht aufgeht, als sie im Kühlregal des Supermarkts angesichts von 800 (!) ausgedruckten Hühnerbiografien Dopplungen erkennt und auf den Nuggetpackungen biografisch „Vermischtes“ erspäht, zeigt, wie weit es mit dem Wirklichkeitsverlust in diesem Roman schon gekommen ist. Da hilft dann angesichts des biographischen Scherbenhaufens nur das Gewehr. Mit der Kugel für Fernand, dem Massaker an Hannahs-Hähnchen, der letzten Kugel für Louis erleben wir ein Gewaltfinale mit Katharsispotential, dessen schlichte Botschaft nur heißen kann:
Finger weg vom Supermarkthähnchen! Note: 4/5 (ai)<<
>> So wie „Ballade“ und „vakuumverpackt“ bereits einen Stilbruch vermuten lassen, so bricht Lucie Rico tatsächlich die gängige Literaturerwartung. Hühner, die uns als Frikassee vertrauter sind denn als charaktervolle Zeitgenossen, werden bei Rico zum Mittelpunkt einer eigenwilligen Geschichte, die, wie bei Balladen üblich, tragisch endet. Diese Ballade kennt keine Reime, wohl aber poetische Biografien, die rhythmisch durch das Werk pulsen. Es sind Empfindungen von Hannah über ihre Hähnchen, mit denen sie eine sehr persönliche Zweisamkeit teilt, um sie am Ende zu schlachten und dem Wochenmarkt zuzuführen. Für Hannah ein naturgegebener Zyklus. Der Roman ist also zunächst eine Grenzüberschreitung zwischen Mensch und Tier. Die Autorin nutzt diese Brücke aber auch, um fundamentale Größen wie Leben und Tod zueinander in Beziehung zu setzen. Und zwar auf verstörend innige Art, so dass Leben und respektvolles Töten zu einer harmonisch stimmigen Einheit verschmelzen. Der urbane Leser zögert zunächst, die grotesk anmutenden Verknüpfungen anzunehmen, wird jedoch bald durch die selbstverständliche Unorthodoxie in den Bann geschlagen. Ein überraschendes Literaturerlebnis für den dem Land entfremdeten Stadtmenschen.
Hannah (36) wird mit dem Tod ihrer Mutter in die Gegenwart ihres früheren Daseins versetzt. Der Mutter hatte man als junge Frau prophezeit, keine Kinder bekommen zu können. Sie wollte das Gegenteil beweisen. Es war ein Unbekannter, der half und unbekannt blieb. Dass auf Kinder kriegen, Kinder haben folgte, war für die junge Mutter eine böse Überraschung. Sie entzog sich der Aufgabe. So wurde Hannah weitgehend unter den Hühnern ihrer Mutter groß, die in diesem Landstrich Frankreichs den Lebensunterhalt garantieren. Jetzt war die Mutter tot und 300 Tiere führungslos.
Hannah findet einen heruntergekommenen Hof vor. Dem Vermächtnis der Mutter folgend, führt sie das Chaos weiter, bis Mutters verwaistes Lieblingshuhn und seine Genossen marktreifen Bauchspeck angesetzt haben. Das Ansinnen wird jedoch zum Spießrutenlauf. Die Dorfbewohner untergraben die Arbeit der Fremdgewordenen. Hannah ist zwar vertraut mit Aufzucht und Schlachtung, doch das Massakrieren verlangt ihr viel ab. Eine innere Stimmigkeit stellt sich erst ein, als sie die todgeweihten Hühner mit sehr persönlichen Abschiedsbiografien in Mutters Kondolenzbuch verewigt. Biografien prangen fortan auch auf den Vakuumbeuteln und fördern nach erheblichen Anlaufschwierigkeiten den Absatz am Marktstand. Die Nachbarschaft neidet ihr den offensichtlichen Erfolg. Doch die resiliente Hannah leistet Widerstand, provoziert, wird niedergeschlagen und findet zunehmend eine tiefe Bestimmung in der großen Geflügelfamilie. Sie bleibt und baut aus. Das Dorf kontert mit fürchterlichen Massakern unter ihren Hühnern. Die Täter bleiben natürlich unerkannt.
Zwischenzeitlich wird der Geschäftsmann Fernand Rabatet auf Hannahs originelle Konzeption aufmerksam, da die Individualisierung des Massenproduktes den Umsatz auch in seinen Supermärkt steigern könnte. Das Hähnchen wird neu geframed, nachdem bio versandet ist. Fortan werden wöchentlich vakuumverpackte Hähnchen mit dokumentierter Identität abgeholt und frische Küken angeliefert. Derweil eskaliert der dörfliche Konflikt. Als das brutale Bashing unerträglich wird, vereinbaren Fernand und Hannah einen Umzug in die Stadt. Da trifft es sich gut, dass Hannahs Lebensgefährte Louis Architekt ist. Zusammen wird der ganz große Wurf eines städtischen Geflügelhochhauses geplant. Den begeisterten Expansionsvisionen von Fernand folgend, gibt es Platz für 10.000 Hähnchen. Louis konzipiert künstliche Computerhimmel und steuerbare Naturstimmungen für das Hühnervolk, während Hannah mit einem Stab engagierter Jungliteraten massenhaft Lebensläufe produziert, Natürlich erst, nachdem kennzeichnende Charakterzüge jedes einzelnen Tieres erkannt waren. Hannah ist göttlich beglückt.
Doch das Paradies hat zerschnittene Grenzzäune. Sie entdeckt schließlich, dass Biografien recycelt werden. Dass Hähnchen in Teilstücken vermarket werden. Dass die einzigartige Individualität ihrer Kreaturen zerstückelt, missachtet, vernichtet wird. Ihr schwant, dass der unerträgliche Verrat, der eines Triumvirats ist. Fernand, der gewissenlose Geschäftsmann. Louis, der es mit gestaltete. Und Hannah, die es als sogenannter Showrunner naiver weise vorantrieb. Die gezogene Konsequenz ist infernal und umfassend. Hannah erschießt alle Tiere und verwendet auch die letzte Kugel. Die An-Spannung reicht über das Buch hinaus, denn wir erfahren nicht, wen diese Kugel trifft: ihr verbleibendes Lieblingshuhn, ihren Freund Louis oder sie selbst? Starker Schockschluss.
Bemerkenswert ist, dass Rico (bewusst oder nicht) in dem bizarren Plot eine Daseinsdiskussion eröffnet. Wie kann es sein, dass „das Leben nehmen“ mit tiefer Annäherung vereinbar bleibt? Hannahs tierische Verbindung ist nicht intellektuell, sondern geradezu körperlich und tief empathisch. Sie teilt mit einem Huhn Bett, Haus und Freizeit. In ihrer Abwesenheit wird die Hühnereinsamkeit mit Fernsehprogrammen gemindert. Gemeinsame Rock`n Roll Momente werden mit gehörig Whiskey für Huhn und Mensch veredelt. Bei gemeinsamen Spritztouren mit dem PKW wird der Geschwindigkeitsrausch ausgekostet, auch wenn ein schwächelndes Hähnchen schon mal in einer zu scharfen Kurve einem Herzinfarkt erliegt. Hier touchiert der Roman surreales Territorium. Hannah sitzt stundenlang im Kreise der Ihren, erfasst die Mentalitäten, erkennt die Müßiggänger, die Schaffer, die Verträumten, die Verräter. Und alle sind ihr nah. Geteiltes Leben trotz des folgenden Tötens.
Der Tod postiert sich hier nicht als Schnitt, der alles nimmt. Der Tod ist die natürliche Vollendung des Lebens. Im Sinne eines Hühnerlebens ist die Schlachtung das natürlichste denkbare Ende. Oder wie die verstorbene Mutter sinngemäß sagte: die Wärme, die wir ihnen gaben, geben sie uns zurück, wenn sie aus dem Ofen kommen. Für die Vegetarierin Hannah ist der Umgang zwingend mit Respekt und unumstößlichen Prinzipien verbunden. Wird einer dieser Werte verletzt, bleibt nur die kollektive Katastrophe. Das atmet Shakespeare. Die Autorin lässt in diesem Part die Protagonistin eine Hannah sein, deren Ursprung schon Besonderes erwarten ließ. Hannah entspricht nicht der Norm. Kauft gigantische Puppenhäuser mit funktionsfähigen Duschen für das Federvieh. Weckt nachts die Hähnchen, um sich mit ihnen zu betrinken. Das gemeinsame Bett mit einem Huhn braucht sie, damit über die Sprachbarriere hinweg die Träume zirkulieren können – eine unverzichtbare Hilfe für authentische Biografien. Von Louis Vier-Finger-Hand ist Hannah so elektrisiert, dass sie unbedingt von diesen quasi „Hühnerzehen“ befriedigt werden will. Braucht es eine Wesensart jenseits der als gesund empfundenen Normalität, um diese Lebensauffassung zu entwickeln? Eine Ethik von Behüten und Töten mit zementierter Rollenverteilung? Oder braucht es das Entrückte gar nicht? Schließlich lebt jeder Landwirt nach dieser Maxime. In jedem Falle eine denkwürdige Denkart.
Lucie Rico sind mit trockenem Humor surreale Bilder gelungen, die den gängigen Erwartungshorizont durchstoßen. Witzig, originell, verstörend und doch tiefsinnig. Stark. Note: 1 (ur) <<
>> Keine Ballade, ein Roman, der blutig beginnt und auch so endet. Es geht um Hühner und „mit einem Huhn hat der Bürger wenig Mitleid“ weiß die FAZ (2. April 2025) in einem ausführlichen Bericht über die steigende Nachfrage nach Geflügelfleisch.
Für Hannah, die Protagonistin des Romans gilt das nicht. Sie empfindet tief für ihre Hühner, für die sie individuelle Nachrufe schreibt. Diese Nachrufe, sensibel beobachtete Mini-Portraits, fein ziselierte sprachliche Kunstwerke, wurden für mich zum Lesegenuß.
Der Roman füllt eine echte Wissenslücke. Denn „die Wissenslage über die Hühnerhaltung sei spärlich“ meint Lasse Brandt, Hühnerbeauftragter des Biolandverbands (wochentaz vom 25. April 2025). Das blutige Ende überrascht und wirkt etwas konstruiert. Eine abschließende Bewertung fällt nicht leicht. Eine schwarze Komödie? Teilweise schon. Immer wieder wird überzeichnet, was Komik hervorruft.
Surreales, Irreales, Bizarres, Absurdes, Irrwitziges, von allem etwas, aber auf jeden Fall amüsant. Note: 1/2 ( ax) <<