Hanser 2025 | 239 Seiten.


Hanser 2025 | 239 Seiten.

 dtv 1981, 404 Seitern
dtv 1981, 404 Seitern
>>Joseph Roths Radetzkymarsch ist mehr als ein Roman über den Niedergang einer Familie oder einer Monarchie – er ist eine Elegie auf eine untergehende Weltordnung. In den Figuren des Hauses von Trotta spiegelt sich über vier Generationen hinweg die gesamte Habsburgermonarchie, deren Glanz schon matt geworden ist, während sie sich selbst noch in die Pose imperialer Größe stellt. Roth erzählt nicht von heroischen Taten, sondern von Zeremonien, Ritualen und hohlen Loyalitätsbekundungen, die wie eine schöne Fassade vor einem Gebäude stehen, das längst Risse trägt.
Gerade in dieser Entlarvung liegt die bleibende Kraft des Romans. Roth beschreibt, wie Gesellschaften sich in Illusionen einrichten: im Glauben an ewige Stabilität, im Vertrauen auf Institutionen, die längst erstarrt sind. Es ist ein kollektives Verdrängen des Zerfalls – ein Phänomen, das sich auch heute beobachten lässt. Auch in unserer Gegenwart klammern sich Gesellschaften an politische Gewissheiten oder nationale Mythen, während im Hintergrund die Weltordnung ins Wanken gerät.
Besonders aktuell wirkt Roths literarische Diagnose im Hinblick auf die „Vorboten eines Krieges“. Radetzkymarsch schildert das langsame Taumeln in die Katastrophe, gespeist aus Selbsttäuschung, Blindheit und der Unfähigkeit, sich neuen Realitäten zu stellen. Man könnte sagen: Roths Figuren sind nicht Opfer von Zufällen, sondern von einer Mentalität, die schlafwandlerisch in den Krieg mündet.
Roths großartige Sprache bespielt einerseits den Glanz der Vergangenheit und zeigt gleichzeitig schonungslos ihre Leere. Diese Ambivalenz – Elegie und Analyse zugleich – macht Radetzkymarsch zu einem großen politischen und literarischen Werk. Es ist nicht nur Erinnerung an ein versunkenes Reich, sondern ein Spiegel, der uns vor Augen hält, wie fragil jede Ordnung ist, wenn sie sich im Pathos einrichtet und das Wirkliche nicht mehr wahrnimmt. Note : 1 – (ün)<<
<<Wir werden Zeuge einer Familiengeschichte der Trottas, in der sich zugleich der Zerfall des habsburgischen Vielvölkerstaates widerspiegelt. Anschaulicher als in jedem Geschichtsbuch vermittelt Joseph Roth ein Sittengemälde einer dynastischen Gesellschaft, deren Strukturen im Wesentlichen bis ins kleinste Detail durch ständische Regularien und Konventionen bestimmt werden. Vater-Sohn Beziehungen gleichen dem Kaiser-Untertanen Prinzip, familiäre Begegnungen gleichen den Ritualen kaiserlicher Audienzbesuche bis in die Art der Kommunikation. Vier Mannesfinger von oben zwei Mannesfinger Abstand vom seitlichen Rand, die äußere Form der Vater-Sohn Briefe auf Oktavbogen, sie spiegeln sich auch im distanziert förmlichen Inhalt. Das Porträt des Helden von Solferino an der Wand des Herrenzimmers von Josef von Trotta und das allgegenwärtige Kaiserporträt zu Pferde, sie stehen im Kleinen wie im Großen für ehrfurchtsvolle Vorbildfunktion. Diese verblasst gänzlich in der Enkelgeneration und mit der fortschreitenden Senilität des Kaisers. Nahm man das Bildnis vom Haken, wie im Epilog beschrieben, hatte die Stunde des letzten Trottas und zugleich des Kaisers geschlagen. Die Symptome der Verfalls prägen die Romanhandlung von Beginn an: Von der gefälschten Legendenbildung der Schlacht von Solferino (Der Held und „Ritter der Wahrheit“ quittiert aus Verbitterung die Armee) über die Auflösung soldatischer Tugenden (mehr „Liebesmanöver“ Casino und Schulden als militärische Disziplin) bis hin zu zunehmend nationalistischen Freiheitsbewegungen (zunächst die Tschechen) und erstem „staatsgefährdenden Umtrieben“ (sozialdemokratische Arbeiterproteste) zieht sich das Band der Auflösung. Es sind nicht nur die großartigen Charakterisierungen des Romanpersonals (selbst Diener-Nebenfiguren erzählen eine eigene Geschichte), die lebendigen Schauplatzbeschreibungen (atmosphärisch am dichtesten die Station des Jägerbataillons von Leutnant Trotta an der russ. Grenze), die von einem Stück menschlicher Tragik geprägten Episoden wie die Slama- und Frau v. Taußig Geschichte oder die brillante Beschreibung der Überlegungen anlässlich des hundertsten Geburtstags des Dragonerregiments, wer denn wie und wann einzuladen sei, die zeigen wie ein historischer Roman zum Lesegenuss wird, sondern es ist vor allem die Sprache des Erzählers, die den Leser zum (an)teilnehmenden Beobachter macht.
Note : 1 (ai)
P.S. „Lassen S‘ die Geschicht“ – der kaiserliche Rat an den Helden von Solferino hier nicht zu verzeihen!
>> Johann Strauss komponierte den Radetzkymarsch als Lobeshymne, nachdem das gefährdete Österreich die Lombardei erobert und den Kaiser zurückbrachte hatte. Jahre später wurde die Lombardei in der Schlacht von Solferino wieder verloren, doch der Kaiser blieb noch ein Weilchen, während der Radetzkymarsch nachklang. 1916 war der Herrscher tot. Das österreichisch-ungarische Kaiserreich zerfiel in zahlreiche Nationalstaaten. Der für seine späte, rückwärtsgewandte Utopie bekannte Autor Josef Roth griff diese Phase des Identitätsverlustes auf. Er selbst war Teil des Reiches gewesen, verfasste das Werk aber erst in der zweiten historischen Verlustphase während des Anschlusses Österreichs an Nazideutschland. Gemessen an den nationalsozialistischen Grausamkeiten erschienen Roth die Absurditäten des untergegangenen Kaiserreiches als liebenswerte Ordnung.
Dennoch atmet das vorliegende Werk diese Sehnsucht nur am Rande. Stattdessen ist es eher vom Odem der Buddenbrooks durchweht. Ein Geschlecht im Niedergang in einer sich neigenden Epoche. Interessanterweise platziert Roth den katapultartigen Aufstieg seiner Protagonisten in den historischen Moment, als die Zersetzung des Reiches Formen annimmt – also in die Schlacht von Solferino. In dieser Schlacht rettet der Infanterist Trotta dem Kaiser das Leben. Das prompte Adelsprädikat für den Helden samt fortwährender Protegierung wird daraufhin über drei Generationen weitervererbt. Auf den Helden folgt der Sohn als dem Militär abgewandter Amtmann und schließlich der dem Militär entfremdete Enkel Karl-Joseph von Trotta. Ihm ist der größte Teil des Werks gewidmet. Den individuellen und den nationalen Faden lässt Roth synchron abreißen, als die Trottas und der Kaiser fast zeitgleich das Zeitliche segnen. Das Buch hat mit der Zusammenführung begonnen und endet auch mit ihr. Protagonisten und politische Ordnung sind jetzt aus der Zeit gefallen.
Am Anfang steht der Bauernsohn und Großvater des Hauptprotagonisten. Er wirft sich als Infanterist in den Kugelhagel, der im Gefecht dem Kaiser gilt. Beide überleben. Der Herrscher belohnt den Untertan. Fortan ist der redliche Held selbst in Schulbüchern verherrlicht. Doch dieser macht sich zum Prinzen auf der Erbse, als er einen kleinen Fehler entdeckt. Der fußläufige Infanterist, der er war, wurde als reitender Kavallerist dargestellt. Für den prinzipientreuen Soldaten eine untragbare Fälschung, die ihn den Heeresdienst quittieren lässt. Vertrieben aus dem Paradies der einfachen Gläubigkeit. In der Folge untersagt er auch seinem Sohn die Militärkarriere. Doch der von nun an adelige Name von Trotta garantiert Auskommen und gehobene Beamtenstellung. Der Sohn wird also angesehener Bezirkshauptmann mit ebenso herrschaftstreuer Gesinnung. Dessen Sohn Karl-Joseph wiederum, der Enkel des Helden, wird wider Willen ins Heer genötigt. Am Ende setzt er zu seiner eigenen Heldentat an, als er beim Wasser holen für verdurstende Kameraden erschossen wird. Im geltenden Wertekodex jedoch ein peinlicher Tod. Gestorben nicht mit der Waffe in der Hand, sondern zwei Wassereimern. Kein Stoff für K&K-Geschichtsbücher.
Der Bezirkshauptmann. In der Vater-Sohn Beziehung verdichtet Roth auf der individuellen Ebene die gesellschaftliche Problematik von Amtsschimmel, Etikettenlähmung, politischen Widersprüchen, Machtmissbrauch und Rollenverpflichtung – auch zwischen den Geschlechtern. Die Zeitläufe folgen einer unumstößlichen Taktung. Im einheitlichen Morgenmoment wird der ausladende Bart frisiert. Die Reihenfolge der Menüteile beim allein absolvierten Mahl erfolgt minutengenau. Der Radetzkymarsch wird jeden Sonntag unter seinem Paradefenster intoniert. Der Zeremonienmeister zelebriert anschließend stets die gleiche Zigarrensorte mit dem Bezirkshauptmann. Die Liste der ewigen Kreisbewegungen ist lang und füllt die Tage. Zwischenzeitlich gilt es den über alles geachteten Kaiser Franz Josef I zu repräsentieren.
Die Beziehung zum einzigen Sohn Karl-Joseph ist entsprechend formal. Ein Sohn ist Bestandteil einer Gesellschaftsmaschinerie. Ein Zahnrad, dessen Zacken sauberst herauszuschleifen sind. Freude und Freunde bleiben unbekannte Größen. Eine empathische Mutter fehlt. Vater-Sohn Gespräche sind Prüfungen. Väterliche Ansagen sind auch im Erwachsenenalter mit „Jawohl, Papa!“ zu quittieren. Schon bald muss sich der Bub in die Kadettenschule und von dort ins Kasernenabseits begeben. Aus der Ferne ist monatlich ein Brief zu schreiben. Über Jahre hinweg wird nie etwas Inhaltliches darin stehen. Die Seitenabstände zum Papierrand werden jedoch bis zum Schluss präzise eingehalten. Der Vater antwortet jedes Mal mit einer Zeile – ebenfalls frei von Inhalten. Das formale Ritual als sich vergewissernder Selbstzweck.
Dann rücken auch für den Alten die Detonationen näher. Der langjährige Hausdiener verstirbt im Dienst. Der Kaiser stirbt. Der Sohn verwahrlost in Suff und Schulden und stirbt würdelos im Krieg. Mit dem regimetreuen Tod seines Sohnes kollabiert schließlich sein Seelenleben. Er schreit den Verlust in die Welt und spürt zu spät, dass er liebte in einer lieblosen Zeit. Im Danach ergibt das Weiterleben keinen Sinn mehr.
Karl-Joseph. Der Sohn hat diesen einen Bezirkshauptmann-Vater. Die Mutter bleibt in der streng reglementierten Kaiserepoche nebulös. Erzogen und noch im Erwachsenenalter wird der Sohn vom leiblichen Vater wie ein Rekrut deklassiert. Pflichterfüllung scheint der einzige Berührungspunkt. Karl-Joseph gehorcht, leidet sich durch die prestigeträchtige Kavallerie, macht sich zu Pferde lächerlich, lässt sich in die geschmähte Infanterie am äußersten Rand des Reiches versetzen. Die Tristesse wird im neunziggrädigen Fusel ersoffen. Mit weichem Herz werden verschuldete Kameraden alimentiert und Huren verwöhnt, bis ein ruinöser Schuldenberg nur noch von Vater samt Kaiserintervention abgetragen werden kann. Der junge Leutnant ist gutmütig, jedoch zunehmend willenlos. Als er schließlich doch den Militärdienst aufkündigt, findet er in einer einfachen Lebensweise vorübergehend Ruhe. Doch dann bricht der I. Weltkrieg aus. Der Kaiser ruft und die verinnerlichte Vaterstimme treibt ihn in den lächerlichen Tod.
Das Werk. Ein Roman im Takt des Radetzkymarsches. Ein eingängiger Rhythmus, in dem sich der Stillstand des dahindösenden Friedens und das Sterben im verordneten Krieg ertragen lassen. Wenn der Krieg die Freiheit des Soldaten ist, dann verdichtet der Radetzkymarsch alle disziplinarischen Gefühle zu einer Siegesparole. Der Marsch wird zur Melodie des Ablebens. Für die von Trottas, für den Kaiser, für das Gesellschaftsgefüge.
Für den Leser ist das Internalisieren dieser Lektüre nicht ohne Mühe: der zeitlich entrückte Inhalt, der mit bedeutenden Details angefüllt ist und verstanden werden will. Die Länge der Betrachtungen. Die Sprache. Und doch wird der Leser auch belohnt mit eloquenten Passagen, und vor allem mit psychologischer Schärfe. Wenn etwa der den Dienst verweigernde Sohn dem Vater die Briefe vorenthält, schreibt Roth: „ Der Sohn schwieg. Aber der Vater hörte ihn schweigen.“ Für seine Zeit vermutlich ein außergewöhnlicher Wurf. Heute jedoch schon ein wenig von gestern. Note: 3 (ur)<<
>> Ein beliebter Text zum Radetzky-Marsch lautet:“Alles klar, alles klar, alles bleibt wie‘s war.“ Für die Schlacht von Solferino vom 24.6.1859 gilt dies nicht. Mit circa 30 000 Toten war sie die blutigste Auseinandersetzung seit der Schlacht von Waterloo.
Henry Dunant schrieb über die Schlacht das Buch „Erinnerung an Solferino“. Dies führte zur Gründung des Roten Kreuzes und zur Vereinbarung der Genfer Konvention von 1863.
Berühmter als das Buch von Dunant ist der Roman Radetzky-Marsch von Joseph Roth, der mit der Schlacht von Solferino beginnt. Bei Wikipedia und Kindler ist der Roman vorbildlich rezensiert. Deshalb beschränke ich mich hier auf einige subjektive Anmerkungen, die einen roten Faden vermissen lassen.
Verhältnis Vater-Sohn: Irritierend die subalternen Floskeln, nicht nur in der schriftlichen Kommunikation. „Jawohl, Vater jawohl.“ Später die hilflose„Kommunikation“ zwischen Vater und betrunkenem Sohn. Eine bewegende Begegnung. Wer ist hier mehr zu bedauern, Vater oder Sohn? Nicht nachvollziehbar ist für mich die Erregung des Vaters über eine übertriebene Darstellung seiner Heldentat in einem Schulbuch, die ihn an den kaiserlichen Hof treibt. Dazu der ironisch-zynische Kommentar eines Notars: “Alle historischen Daten werden für den Schulgebrauch anders dargestellt“. Ein Satz, der jeden Schulbuchautor auf die Palme bringen sollte.
Sterben und Tod: In der Schilderung von Sterbeprozessen zeigt Roth große Meisterschaft. Geht es ihm wie seiner Romanfigur Carl Joseph über den er schreibt:“Er genoß die Nähe des Todes…“?
Dies gilt auch überwiegend für erotische Schilderungen. Die Verführung des jungen Carl Joseph wird in dem genialen Satz „eine große Welle aus Wonne, Feuer, Wasser“ resümiert.
Roth hat ein Faible für Frösche. Ich habe nicht gezählt, wie oft Frösche in den unendlichen Sümpfen quaken. Auch nicht wie oft zum 90 Prozentigen gegriffen wird, fast schon ein roter Faden des Geschehens.
Ein geringer handwerklicher Fehler unterläuft dem Autor, wenn er in einem slowenischen Dorf eine Moschee ansiedelt.
Nicht erstaunlich, dass der Roman mehrmals verfilmt wurde. Der Satz „Und es war Sommer“ (Seite 24) könnte Peter Maffay zu seinem erfolgreichsten Lied inspiriert haben.
Man verzeihe mir die Egozentrik, wenn ich den Satz „Der liebe, gute Max!“ für den schönsten des Romans halte. Note: 2 (ax) <<
 Mattes&Seitz, 2024 | 235 Seiten.
Mattes&Seitz, 2024 | 235 Seiten.
<<Hannah erbt von der schon reichlich skurrilen und kaltherzigen Mutter einen Hühnerhof mit 300 Hühnern, darunter erstaunlich viele Einbein- und Einäugige. War die Mutter schon sehr schräg drauf, entwickelt auch Erbin Hannah eine innige, pathologisch überdrehte Beziehung zu den Hühnern und hat bald die brillante Idee, zu jedem Hähnchen, das sie auf dem Markt verkauft, eine Biografie mitzuliefern, was beim Publikum gut ankommt. So weit so gut. Was Hannah dann aber – in einem lakonischen Präsens erzählt – an Verrücktheiten abliefert, geht auf keine Kuh- sorry Hähnchenhaut.
So liebt sie den „strengen Geruch der Hühner mehr als Louis Liebesbekundigungen“. Louis ist ihr Mann , der noch in der Stadt wohnt und sie mit Fotos versorgt, damit sie masturbieren kann.
Für die Hühner wird ein Spielplatz mit Rutsche gebaut, sie dürfen auch mit fernsehen und mit ins Bett oder sie schlafen im Hundekörbchen. Die Hähnchen nennen sie „Menschenskinder“.
Hannah ist allerdings Vegetarierin und redet im Zusammenhang mit dem Verkauf der Hähnchen ständig und penetrant von „Leichenteilen“, von „Exekutionen“, „Todesurteilen“. Auch als ihr 4 fingriger Mann Louis nachts heimlich ein Stück Wurst isst, ekelt sich Hannah. “Ein obszöner Wurstgeruch geht von ihm aus“.
Am Ende eskaliert das ganze Unternehmen in einer absurden Gewaltorgie, als die Hähnchen mit Biografie in Massen an Supermärkte verkauft werden.
Ein recht plumpes und ärgerliches Plädoyer gegen den Verzehr von Hähnchenfleisch, frei von jeglicher Logik und ohne Witz. Note: 5 ( ün) <<
>> Ja, ein roter Faden zieht sich durch die Geschichte der 36jährigen Hannah, doch diese Blutspur ist voller Ungereimtheiten, nicht nur das Genre Ballade betreffend. Ein reichlich schräges Theodore-Vermächtnis der Mutter macht die Vegetarierin, die kein Fleisch mehr essen und kein Hühnchen mehr schlachten kann, binnen kurzem zur Hühnchenvertrauten. Um den „strengen Geruch“ des Federviehs „mehr zu lieben“ als „die Liebesbekundungen“ ihres Ehemanns Louis, bedarf es allerdings einer kühnen Verwandlung des Tiers zum „Menschenkind“. Der Hühnerhof im Dorf ihrer Kindheit wird zum Ort liebevoller Zuwendung mit gelegentlicher Einzelbetreuung. Eine exklusive Minibiografie ziert jede Vakuumverpackung. Das einzelne Huhn wird posthum zur „Persönlichkeit“. So sehr es in der Hühnerschaar von 300 auch menschelt, Hannahs lustvoll praktizierte Exekutionsformen wie Halsumdrehen, Messersticke, Beil machen aus der Überhöhung und Individualisierung das Tier zur Ware. Dass mit dem Auftritt Fernand Rabatet eine ganz neue Form der Vermarktung und Kommerzialisierung beginnt, lässt schon ahnen, dass uns kein Happy-end erwartet. Der Vertrag, der Hannah zur Komplizin im Tierhandel großen Stils macht, erfährt – ethisch abgesichert – letztlich auch die Zustimmung der Hühner. Jetzt brechen alle Dämme. Der Hühnerstall wird zur Fleischfabrik . Mehrgeschossige Lebenshalle, Leichenhalle, Observatorium (Beobachtungsposten) aus weißem Beton. Entworfen von Louis , Ehemann und Architekt, dessen eigentliches Arbeitsgebiet: Projektplanung für Abu Dhabi (!!) Das Interieur Kunstrasen, Puppenhäuser, Spielgeräte, Kunsthimmel mit „ewigem Frühling“. Platz für 10.000 Hühner. Dass Hannah hier „eine Armee von untoten Hühnern unter einem Antihimmel, zum Angriff bereit“, vorfindet, ändert zunächst nichts an der Illusion einer persönlichen Mensch-Tier Beziehung. Als kleiner Ausflug in die Abteilung „Slapstick“ dienen Lyriklesungen für Hühner, die Kochtopf-Exekution des Sohnersatzes Aval oder etwas umfangreicher die Rekrutierungsepisode der neu einzustellenden Texter. Dass Hannah schlussendlich erst ein Licht aufgeht, als sie im Kühlregal des Supermarkts angesichts von 800 (!) ausgedruckten Hühnerbiografien Dopplungen erkennt und auf den Nuggetpackungen biografisch „Vermischtes“ erspäht, zeigt, wie weit es mit dem Wirklichkeitsverlust in diesem Roman schon gekommen ist. Da hilft dann angesichts des biographischen Scherbenhaufens nur das Gewehr. Mit der Kugel für Fernand, dem Massaker an Hannahs-Hähnchen, der letzten Kugel für Louis erleben wir ein Gewaltfinale mit Katharsispotential, dessen schlichte Botschaft nur heißen kann:
Finger weg vom Supermarkthähnchen! Note: 4/5 (ai)<<
>> So wie „Ballade“ und „vakuumverpackt“ bereits einen Stilbruch vermuten lassen, so bricht Lucie Rico tatsächlich die gängige Literaturerwartung. Hühner, die uns als Frikassee vertrauter sind denn als charaktervolle Zeitgenossen, werden bei Rico zum Mittelpunkt einer eigenwilligen Geschichte, die, wie bei Balladen üblich, tragisch endet. Diese Ballade kennt keine Reime, wohl aber poetische Biografien, die rhythmisch durch das Werk pulsen. Es sind Empfindungen von Hannah über ihre Hähnchen, mit denen sie eine sehr persönliche Zweisamkeit teilt, um sie am Ende zu schlachten und dem Wochenmarkt zuzuführen. Für Hannah ein naturgegebener Zyklus. Der Roman ist also zunächst eine Grenzüberschreitung zwischen Mensch und Tier. Die Autorin nutzt diese Brücke aber auch, um fundamentale Größen wie Leben und Tod zueinander in Beziehung zu setzen. Und zwar auf verstörend innige Art, so dass Leben und respektvolles Töten zu einer harmonisch stimmigen Einheit verschmelzen. Der urbane Leser zögert zunächst, die grotesk anmutenden Verknüpfungen anzunehmen, wird jedoch bald durch die selbstverständliche Unorthodoxie in den Bann geschlagen. Ein überraschendes Literaturerlebnis für den dem Land entfremdeten Stadtmenschen.
Hannah (36) wird mit dem Tod ihrer Mutter in die Gegenwart ihres früheren Daseins versetzt. Der Mutter hatte man als junge Frau prophezeit, keine Kinder bekommen zu können. Sie wollte das Gegenteil beweisen. Es war ein Unbekannter, der half und unbekannt blieb. Dass auf Kinder kriegen, Kinder haben folgte, war für die junge Mutter eine böse Überraschung. Sie entzog sich der Aufgabe. So wurde Hannah weitgehend unter den Hühnern ihrer Mutter groß, die in diesem Landstrich Frankreichs den Lebensunterhalt garantieren. Jetzt war die Mutter tot und 300 Tiere führungslos.
Hannah findet einen heruntergekommenen Hof vor. Dem Vermächtnis der Mutter folgend, führt sie das Chaos weiter, bis Mutters verwaistes Lieblingshuhn und seine Genossen marktreifen Bauchspeck angesetzt haben. Das Ansinnen wird jedoch zum Spießrutenlauf. Die Dorfbewohner untergraben die Arbeit der Fremdgewordenen. Hannah ist zwar vertraut mit Aufzucht und Schlachtung, doch das Massakrieren verlangt ihr viel ab. Eine innere Stimmigkeit stellt sich erst ein, als sie die todgeweihten Hühner mit sehr persönlichen Abschiedsbiografien in Mutters Kondolenzbuch verewigt. Biografien prangen fortan auch auf den Vakuumbeuteln und fördern nach erheblichen Anlaufschwierigkeiten den Absatz am Marktstand. Die Nachbarschaft neidet ihr den offensichtlichen Erfolg. Doch die resiliente Hannah leistet Widerstand, provoziert, wird niedergeschlagen und findet zunehmend eine tiefe Bestimmung in der großen Geflügelfamilie. Sie bleibt und baut aus. Das Dorf kontert mit fürchterlichen Massakern unter ihren Hühnern. Die Täter bleiben natürlich unerkannt.
Zwischenzeitlich wird der Geschäftsmann Fernand Rabatet auf Hannahs originelle Konzeption aufmerksam, da die Individualisierung des Massenproduktes den Umsatz auch in seinen Supermärkt steigern könnte. Das Hähnchen wird neu geframed, nachdem bio versandet ist. Fortan werden wöchentlich vakuumverpackte Hähnchen mit dokumentierter Identität abgeholt und frische Küken angeliefert. Derweil eskaliert der dörfliche Konflikt. Als das brutale Bashing unerträglich wird, vereinbaren Fernand und Hannah einen Umzug in die Stadt. Da trifft es sich gut, dass Hannahs Lebensgefährte Louis Architekt ist. Zusammen wird der ganz große Wurf eines städtischen Geflügelhochhauses geplant. Den begeisterten Expansionsvisionen von Fernand folgend, gibt es Platz für 10.000 Hähnchen. Louis konzipiert künstliche Computerhimmel und steuerbare Naturstimmungen für das Hühnervolk, während Hannah mit einem Stab engagierter Jungliteraten massenhaft Lebensläufe produziert, Natürlich erst, nachdem kennzeichnende Charakterzüge jedes einzelnen Tieres erkannt waren. Hannah ist göttlich beglückt.
Doch das Paradies hat zerschnittene Grenzzäune. Sie entdeckt schließlich, dass Biografien recycelt werden. Dass Hähnchen in Teilstücken vermarket werden. Dass die einzigartige Individualität ihrer Kreaturen zerstückelt, missachtet, vernichtet wird. Ihr schwant, dass der unerträgliche Verrat, der eines Triumvirats ist. Fernand, der gewissenlose Geschäftsmann. Louis, der es mit gestaltete. Und Hannah, die es als sogenannter Showrunner naiver weise vorantrieb. Die gezogene Konsequenz ist infernal und umfassend. Hannah erschießt alle Tiere und verwendet auch die letzte Kugel. Die An-Spannung reicht über das Buch hinaus, denn wir erfahren nicht, wen diese Kugel trifft: ihr verbleibendes Lieblingshuhn, ihren Freund Louis oder sie selbst? Starker Schockschluss.
Bemerkenswert ist, dass Rico (bewusst oder nicht) in dem bizarren Plot eine Daseinsdiskussion eröffnet. Wie kann es sein, dass „das Leben nehmen“ mit tiefer Annäherung vereinbar bleibt? Hannahs tierische Verbindung ist nicht intellektuell, sondern geradezu körperlich und tief empathisch. Sie teilt mit einem Huhn Bett, Haus und Freizeit. In ihrer Abwesenheit wird die Hühnereinsamkeit mit Fernsehprogrammen gemindert. Gemeinsame Rock`n Roll Momente werden mit gehörig Whiskey für Huhn und Mensch veredelt. Bei gemeinsamen Spritztouren mit dem PKW wird der Geschwindigkeitsrausch ausgekostet, auch wenn ein schwächelndes Hähnchen schon mal in einer zu scharfen Kurve einem Herzinfarkt erliegt. Hier touchiert der Roman surreales Territorium. Hannah sitzt stundenlang im Kreise der Ihren, erfasst die Mentalitäten, erkennt die Müßiggänger, die Schaffer, die Verträumten, die Verräter. Und alle sind ihr nah. Geteiltes Leben trotz des folgenden Tötens.
Der Tod postiert sich hier nicht als Schnitt, der alles nimmt. Der Tod ist die natürliche Vollendung des Lebens. Im Sinne eines Hühnerlebens ist die Schlachtung das natürlichste denkbare Ende. Oder wie die verstorbene Mutter sinngemäß sagte: die Wärme, die wir ihnen gaben, geben sie uns zurück, wenn sie aus dem Ofen kommen. Für die Vegetarierin Hannah ist der Umgang zwingend mit Respekt und unumstößlichen Prinzipien verbunden. Wird einer dieser Werte verletzt, bleibt nur die kollektive Katastrophe. Das atmet Shakespeare. Die Autorin lässt in diesem Part die Protagonistin eine Hannah sein, deren Ursprung schon Besonderes erwarten ließ. Hannah entspricht nicht der Norm. Kauft gigantische Puppenhäuser mit funktionsfähigen Duschen für das Federvieh. Weckt nachts die Hähnchen, um sich mit ihnen zu betrinken. Das gemeinsame Bett mit einem Huhn braucht sie, damit über die Sprachbarriere hinweg die Träume zirkulieren können – eine unverzichtbare Hilfe für authentische Biografien. Von Louis Vier-Finger-Hand ist Hannah so elektrisiert, dass sie unbedingt von diesen quasi „Hühnerzehen“ befriedigt werden will. Braucht es eine Wesensart jenseits der als gesund empfundenen Normalität, um diese Lebensauffassung zu entwickeln? Eine Ethik von Behüten und Töten mit zementierter Rollenverteilung? Oder braucht es das Entrückte gar nicht? Schließlich lebt jeder Landwirt nach dieser Maxime. In jedem Falle eine denkwürdige Denkart.
Lucie Rico sind mit trockenem Humor surreale Bilder gelungen, die den gängigen Erwartungshorizont durchstoßen. Witzig, originell, verstörend und doch tiefsinnig. Stark. Note: 1 (ur) <<
>> Keine Ballade, ein Roman, der blutig beginnt und auch so endet. Es geht um Hühner und „mit einem Huhn hat der Bürger wenig Mitleid“ weiß die FAZ (2. April 2025) in einem ausführlichen Bericht über die steigende Nachfrage nach Geflügelfleisch.
Für Hannah, die Protagonistin des Romans gilt das nicht. Sie empfindet tief für ihre Hühner, für die sie individuelle Nachrufe schreibt. Diese Nachrufe, sensibel beobachtete Mini-Portraits, fein ziselierte sprachliche Kunstwerke, wurden für mich zum Lesegenuß.
Der Roman füllt eine echte Wissenslücke. Denn „die Wissenslage über die Hühnerhaltung sei spärlich“ meint Lasse Brandt, Hühnerbeauftragter des Biolandverbands (wochentaz vom 25. April 2025). Das blutige Ende überrascht und wirkt etwas konstruiert. Eine abschließende Bewertung fällt nicht leicht. Eine schwarze Komödie? Teilweise schon. Immer wieder wird überzeichnet, was Komik hervorruft.
Surreales, Irreales, Bizarres, Absurdes, Irrwitziges, von allem etwas, aber auf jeden Fall amüsant. Note: 1/2 ( ax) <<
 >>Deutscher Buchpreis 2024, die Latte liegt hoch. Da kann die Kritik auch schon mal heftig ausfallen. Dieses Buch reißt die Latte nicht, es läuft unten durch. Ich werde den Verdacht nicht los, dass andere, literaturfremde Gründe eine Rolle bei der Vergabe gespielt haben: Die Autorin, eine Frau aus der freien, linken Theaterszene Leipzigs, die den woken, mutmaßlichen Zeitgeist bedient. Es geht viel um Tatoos, da wird im Text gegendert, da ist – ernst gemeint von einer „Performerin, weiblich gelesen“ die Rede. Das ist selbst in der immanenten Genderlogik, mit Verlaub, offensichtlicher Blödsinn. Die Love-Scammer aus Nigeria, die unzählige Frauen ins finanzielle und emotionale Unglück stürzen, ernten viel Verständnis, rächen sie sich doch an den Nachfahren der ehemaligen Kolonialmächte. Kritische Recherchen dazu werden beiläufig abgetan. („Was soll man von SPIEGEL TV auch erwarten“). Das Ballett ist natürlich „kolonialer als die stärkste Kolonialmacht, weil es immer an weiße Körperideale“ geknüpft ist. Bei geschilderten Fahrscheinkontrollen in Leipzig beobachtet sie, wenig überraschend, latenten Rassismus. Das ganze Buch dann selbstredend von einem „Sensitivity Reader“ geglättet, der die Autorin auf „verborgene Machtgefälle und Diskriminierungen aufmerksam machte“, wie die Autorin in einem umfangreichen Nachwort bekennt.
>>Deutscher Buchpreis 2024, die Latte liegt hoch. Da kann die Kritik auch schon mal heftig ausfallen. Dieses Buch reißt die Latte nicht, es läuft unten durch. Ich werde den Verdacht nicht los, dass andere, literaturfremde Gründe eine Rolle bei der Vergabe gespielt haben: Die Autorin, eine Frau aus der freien, linken Theaterszene Leipzigs, die den woken, mutmaßlichen Zeitgeist bedient. Es geht viel um Tatoos, da wird im Text gegendert, da ist – ernst gemeint von einer „Performerin, weiblich gelesen“ die Rede. Das ist selbst in der immanenten Genderlogik, mit Verlaub, offensichtlicher Blödsinn. Die Love-Scammer aus Nigeria, die unzählige Frauen ins finanzielle und emotionale Unglück stürzen, ernten viel Verständnis, rächen sie sich doch an den Nachfahren der ehemaligen Kolonialmächte. Kritische Recherchen dazu werden beiläufig abgetan. („Was soll man von SPIEGEL TV auch erwarten“). Das Ballett ist natürlich „kolonialer als die stärkste Kolonialmacht, weil es immer an weiße Körperideale“ geknüpft ist. Bei geschilderten Fahrscheinkontrollen in Leipzig beobachtet sie, wenig überraschend, latenten Rassismus. Das ganze Buch dann selbstredend von einem „Sensitivity Reader“ geglättet, der die Autorin auf „verborgene Machtgefälle und Diskriminierungen aufmerksam machte“, wie die Autorin in einem umfangreichen Nachwort bekennt.
Ein bisschen Namensgebung aus der römisch-griechischen und ägyptischen Mythologie (Jupiter, Juno, Benu) für die Protagonisten und der als Klammer wirkende, düstere Lars von Trier Film Melancholia, reichen nicht aus, der Geschichte wirklich Tiefe zu geben. Es hätte eine spannende Geschichte werden können. Berührende Ansätze über das Gefühl von Juno eine Außenseiterin zu sein in Kindheit und Jugend gibt es schon. Aber bei den Dialogen mit dem schnell entlarvten Love-Scammer Benu stellt sich trotz vieler „Tränenlachsmileys“ rasch Langeweile ein. Sie bleiben oberflächlich, man erfährt fast nichts über ihn. Der Roman tritt auf der Stelle. Oder ist die Ödnis Programm?
„Ein Roman, der sein Versprechen nicht einlöst“, urteilt Katharina Teutsch im Deutschlandfunk. Da kann ich mich anschließen.<< Note 5+ (ün)
>> In Martina Hefters Roman grüßt mit aufweckendem Grundton die in prekären Verhältnissen lebende Protagonistin Juno. Sie grüßt nicht nur ihren schwerkranken Lebenspartner und einen virtuell-realen Nigerianer im Social Media Universum, sondern auch sich selbst. Es ist ein motivierendes Atmen, während der Feinstaub schicksalhafter Nebel sich schon lange in ihrem Umfeld festgesetzt hatte. Ihr Partner, von fortgeschrittener multipler Sklerose gezeichnet, ist zwingend auf ihre Hilfe angewiesen. Der gemeinsame Lebensunterhalt ist für sie als freischaffende Künstlerin nicht garantiert. Das Selbstwertgefühl der gut Fünfzigjährigen auf der Ballettbühne wird immer mehr in Frage gestellt. Es ist ein atemloses Hasten vor dem Bühnenbild ihres Dasein. Und doch findet Juno und das Geschehen dieses Plots festen Halt. Ja, er bleibt am Ende mit einer hellen Aura in Erinnerung des Lesers ohne kitschig zu werden.
Vordergründig gruppiert sich das Geschehen um einen Internet Dialog. Es ist eine andere Bühne. Juno füllt die schlaflosen Nächte mit provozierenden Abenteuern auf Internet-Kontaktbörsen. Sie wirft die Angel aus, bietet sich als kleinen Frischfang, um im nächsten Moment die anbeißenden Männer bloßzustellen. Es ist ein Wechselspiel auf Augenhöhe. Die Lüge ist der Ball, den sich beide Seiten zuwerfen. Die Männer/Frauen/Diverse tragen Fake-Namen, leben im Fake-Luxus, machen Fake-Versprechungen. Am Ende wollen sie Geld oder Sex oder beides. Juno dagegen will Unterhaltung. Was zunächst nur als Ablenkung begann entwickelt Suchtcharakter.
Überraschend gewinnt einer dieser Kontakte an Stabilität und macht eine Metamorphose durch. Um das anspruchslose Zwiegespräch zwischen Juno und dem Nigerianer Benu sortiert die Autorin ein zunehmend komplexer werdendes Psychogramm der Protagonistin. Juno sendet Stichworte an Benu. Diese sind vor allem Aufhänger für die eigenen Gedankengänge. Über den Fremden im Äther geht Juno immer stärker auf sich selbst zu. Schleichend gibt sie immer mehr von sich preis – so wie Benu offensichtlich auch von sich. Ihr Misstrauen wird schließlich von Zuneigung verdrängt. Es wird in dem Moment laut und vernehmlich, als Benus Profil auf der Love Scammer Plattform leer bleibt. Am Ende erscheint diese Virtualität selbst virtuell. Realer wird gleichzeitig Junos In-sich-Ruhen. Der zerstörerische Planet Melancholia entschwindet aus ihrem Horizont.
Mit dem Fortschreiten der Seitenzahlen rahmt Martina Hefter die kurzen Internet-Dialoge immer mehr durch auktoriale Erzählstränge ein. Die Tiefenschichtung der Gestalt Juno tritt zunehmend an die Oberfläche. Rückblicke in die holprige Kindheit. Alltagserschöpfung im Hier und Jetzt. Aufopferung für den genügsamen Partner. Erfüllung im kreativen Tanz. Ihre nächtlichen Ventile für den seelischen Überdruck. Wir beginnen den Menschen Juno zu kennen.
Juno war früh die Außenseiterin. In der Schule gemieden, sich nicht einfügend. Ein bisschen Punk, ein bisschen Frühintellektuelle. Die extravaganten zerschlissenen Klamotten, das vorzeitige Eindringen in die Astrophysik, die irrwitzige Begeisterung für das Ballett. Freie Theatertätigkeit am Existenzminimum, Liebschaften, keine Kinder, aber einen lieben Jupiter, ihr kranker Lebenspartner. Noch jetzt kreisen die Himmelskörper mit stabiler Gravitation umeinander.
In diesem Lebenslauf werden auch Werte neu justiert. Lüge. Wahrheit. Love Scamming ist Lüge. Oder wird nicht auch das angeboten, was der Selbstwahrnehmung – vielleicht auch der Selbstlüge – entsprechen soll? Was ältere Frau vom fremden Mann hören will? Dass es eine Restattraktivität gibt.
Oder das Ballett. Auch nur eine Fälschung jenseits der Wirklichkeit. Bilder ohne Realität. Oder, die von Juno bemühten und in den Sternbildern verewigten Mythologien. Sentenzen der Unwirklichkeit. Der Lüge? Ist Fantasie Lüge? Und wenn ja, braucht Wahrheit dann nicht immer wieder eine ordentliche Portion davon? Juno ist mehr als eine nächtliche Love Scamming Kandidatin.
Dass all das nicht ohne Schwermut ist, ruft Hefter auch mit einem wiederkehrenden Motiv in Erinnerung. Der Kinofilm Melancholia: ein vagabundierender Planet zerstört die Erde. Nicht zerstört wird bis zuletzt die Nähe zweier Schwestern. Und das just in dem Moment, wo die eine gerade heiratet. Juno ist fasziniert von dem Film, weil er nichts beschönigt. Hier also ohne Lüge. Aber ohne Fortsetzung. Immerhin hat die Melancholie ein Ende.
Zu guter Letzt ist erstaunlich (aber ermutigend), dass dieser Roman Anerkennung in Form des Deutschen Buchpreises findet, obwohl das Ende nur bedingt offen ist und vieles sich zum Positiven wendet. Junos erste eigene Ballettinszenierung wird bejubelt, Jupiters Romanmanuskript findet ein großes Verlagshaus, ein Buchpreis entschärft die Finanzsorgen, Jupiter kehrt nach einem erneuten MS Schub stabilisiert aus dem Krankenhaus zurück. Fast eine undeutsch positive Machart. Befremdlich bleibt jedoch die (Buchpreis-förderliche?) auferlegte Zensur. Mit Dank erwähnt die Autorin das sensitivity reading, und meint damit die auswärtige Sprach- und Inhaltskontrolle ihres Werkes, um allen Gender-, Rassismus- und antizipierten Kritikpunkten der lesenden Öffentlichkeit gerecht zu werden. Der Pfad zur Rasterliteratur? Auch wenn diese Form der vorauseilenden political correctness correction wie eine Verpflichtung zum main stream klingt, bleibt dennoch genügend Lesestoff. Note: 2 – (ur)<<
>> Lieber als jetzt über ihr Buch zu schreiben, hätte ich ihre multimediale Performance „Soft War“ in der Dependance des Leipziger Schauspielhauses angeschaut. Aber alle sieben Vorstellungen waren ausverkauft.
Also doch zum Buch, auf dessen Rückseite zu lesen ist „Martina Hefter hat ein göttliches Buch geschrieben“ (FAZ). Das steigert die Vorfreude. Der Inhalt des Romans ist dem Lesenden sicherlich bekannt. Es gewährt wertvolle Einblicke in das Leben kulturschaffender Menschen, die am unteren Existenzminimum leben und auf den großen Durchbruch hoffen. Überraschend auch, wie selbst diese Welt von Bürokratie geprägt wird. Wäre ich im Tätowiergewerbe tätig, würde ich das Buch kostenlos verteilen. Soviel kostenlose Werbung in einem Buch für eine problematische Körperverletzung. Eher ärgerlich. Die Rechtfertigung der afrikanischen Love-Scammer mit der früheren kolonialen Ausbeutung des afrikanischen Kontinents ist problematisch.
Lesen bildet: Ich weiß jetzt, dass ein Tränenlachsmiley nichts mit Lachs zu tun hat und dass das Sturzbächeweinen-Emoji sparsam verwendet werden sollte.
Sympathisch finde ich, dass die Autorin am Ende auf anderthalb Seiten „vielen wunderbaren Menschen“ für ihre Begleitung dankt. Note: 3 (ax)<<
>>Da wird ein Roman gehypt (Die FAZ spricht von einem „göttlichen Buch“), aber der Leser wird enttäuscht. Dabei sind die zwei Welten der Performancekünstlerin Juno mit ihrem MS erkrankten Mann Jupiter und die vorwiegend nächtliche Gegenwelt der Scamming- und Chatszene mit der Schlüsselfigur Benu eigentlich Stoff für eine große Geschichte. Stattdessen bilanziert die allwissende Erzählerin nüchtern: „Juna Isabella Block schreibt immer morgens zwischen sieben und acht im Bett, wenig später geht’s los zum Tanzen, manchmal schreibt sie auch abends und nachts. Einen Text über Tattoos, den Planet Melancholia, über ältere Frauen, Love-Scammer, Nigeria.“ (129). Diese Zusammenfassung hätte sicherlich nicht zum Deutschen Buchpreis gereicht. Heutzutage dagegen all das, was sich unter der Kategorie „Zeitgeist“ und „woke“ subsummieren ließe. Dazu hätte es allerdings nicht des peinlichen Schlussdanks der Autorin bedurft. Wer selbst zum Schreiben einen „Sensitivity Reading“ Coach (weiblich gelesen!!) benötigt, der sollte es beim Tanzen belassen. Note: 4 (ai) <<
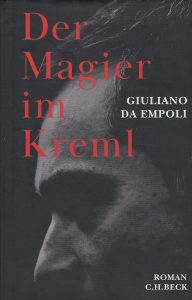 C.H. Beck | 265 Seiten
C.H. Beck | 265 Seiten
>> Eingebettet in eine kurze Rahmenhandlung führt uns ein 226seitiger Monolog des Spindoktor Wladimir Baranow ins Innere des Kremlschen Machtapparats. Manch Akteure und Ereignisse sind aus den Medien bekannt, aber dieser Roman deckt das subtile Netz und die Mechanismen dahinter auf, aus denen totalitäre Herrschaft besteht. Mit dem Zusammentreffen des eiskalten FSB-Apparatschik und Emporkömmling Putin und dem in der Schule des Medienmoguls Beresowskis großgewordenen jungen Regisseur und ideologischen Strategen beginnt ein raffinierter Plan zu Etablierung absoluter Macht. Der Erfolg des Konzepts speist sich aus dem Zerfall der Sowjetunion. Hinter den kleinen Demütigungen wie Gorbatschows Glas Milch statt Wodka, dem Suffkopfimage Jelzins, verbergen sich tiefe Verwundungen der russischen Seele. Da geht es um den Verlust von „Heimat“, die der Roman in einfachen aber eindrucksvollen Bildern beschreibt (300 Millionen Menschen in der UdSSR waren in einer Heimat ausgewachsen und fanden sich plötzlich in einem Supermarkt wieder, die Stärke und Würde des Modells Datscha mit Gemüsegarten missachtet, Helden der Geschichte durch Hollywood ersetzt). Die 90er Jahre entpuppen sich als Ausverkauf des großen Imperiums: Chaos und westliche Dekadenz, Raffgierkapitalismus, der Aufstieg neuer Oligarchen, Zurschaustellung von Äußerlichkeitsattributen. Baranows eigene traditionsreiche Familiengeschichte ist ein Spiegel des Niedergangs in der Umbruchphase nach 1989 und vielleicht erklärt sich daraus auch seine Mittäterschaft („Mein Vater verlor unter Gorbatschow seine Arbeit, die Privilegien, die Ehre“). So schlicht vordergründig das Modell der Wiederherstellung von Ordnung, so erfolgreich: Man vergrößere das Chaos, steigere die Wut und Ängste des Volkes, benenne einzelne Verantwortliche und strafe sie medienwirksam entweder öffentlich ab (Chodorkowki) oder bediene sich dezent willfähriger Lakaien („Das waren nicht wir. Wir schaffen lediglich die Voraussetzung für die Möglichkeit“ so kommentiert Putin den Mord an Beresowski), überführe privatisierte Unternehmen wieder in staatliche Konglomerate, übernehme wieder die Medien (vaterländische Geschichte statt „barbarisches und vulgäres Fernsehen des ORT), schließe ein Bündnis von Politik, Militär, Sicherheitsapparat kurz, befriedige „die Sehnsucht der Russen nach Vertikalität“: Solchermaßen vorbereitet kann dann Putin, der Zar, übernehmen. Die Wiederherstellung alter russischer Größe bedarf auch eines propagandistischen Instrumentariums, dessen sich Baranow im Schutze des Zaren meisterhaft bedient. Da wird Geschichte durch lineare Freund-Feind-Bilder glattgebügelt: Orangene Revolution – eine CIA Inszenierung , Georgien, Kirgisistan – von westlichen Finanzmärkten unterwandert, Staatsstreich-Phantasien, kurz, die „Dekadenz des Westens“ ist die eigentliche Bedrohung des russ. Imperiums. Auf der Basis solcher Verschwörungstheorien ist es auch schlüssig, dass es Baranow gelingt um die zwielichtigen Gestalten von „Putins Petersburger Freunden“ (Biker-Gangs) selbst die populären Gruppen der alternativen Szene zur patriotischen Phalanx zu versammeln. Gelingt es dann noch mit dem Propagandaerfolg der Olympischen Spiele in Sotschi schlüssig zu vermitteln, die Krim einen Monat danach zurückzuerobern, „weil sie uns gehört“, dann ist dem Magier im Kreml die Anerkennung Putins sicher („Es war klar, dass er die Spiele als den Höhepunkt seiner Herrschaft betrachtete“). Dass Baranows „raffinierte Lösung“, auch die Ukraine durch eine der Moskauer Chaostheorie entsprechende Befreiung durch den Zaren wieder ins Imperium zurückzuholen, nicht aufgehen und er sich schließlich doch dem Kriegsdiktat beugt ((„als der Zar diesen Krieg beschlossen hatte, tat ich alles in meiner Macht stehende, ihn zu Erfolg zu führen“), macht ihn – mit einer „verdreckten Puppe“ aus dem Schutt des Dombass in der Hand letztlich zu einer tragischen Figur. „Kein großer Regisseur höchstens Komplize“, die Schlüsselstelle auf S. 234 weist die Spur.
Baranows Demission vom Hof bedeutet die Rückkehr zu der Bibliothek seines Großvaters. Und während Putin der Merkelsche Labrador als „einziger Berater bleibt, dem er voll und ganz vertraut“ weitet sich der Blick Baranows und entfernt sich zunehmend von der realen Diktatur im Kreml. Von Samjatins dystopischem Roman „Wir“ aus den 20er Jahren (er hat im Roman eine Klammerfunktion) über die LSD-geschädigten Kalifornier der Militärtechnologie, über das Menetekel von Atombombe, Virus, Sensoren- und Roboterarmeen führt alles zu der Gewissheit, dass es mit er Menschheitsgeschichte dem Ende zugeht. Während Kap. 30 mit dem noch offenen Kampf zwischen der doch recht christlich anmutenden „Ankunft des Herrn“ und der recht prosaischen „Apokalypse“ des letzten vom Computer erzeugten Algorithmus endet, keimt im Schlusskapitel noch ein kleiner Schimmer von Hoffnung auf und auch mir tat es gut, aus dem Auge eines 5 jährigen Mädchens zu vernehmen, das dem Magier im Kreml als „Papa“ doch nicht alle Menschlichkeit abhandengekommen war. Dass sich hinter Anja auch eine Xenja-Geschichte verbirgt, soll nicht unerwähnt bleiben.
Der Roman vermittelt differenzierte Einblicke in das System Putin. Er ist zugleich ein Psychogramm des modernen Zaren wie seines propagandistischen Begleiters und zeigt, was unter russischer Seele zu verstehen ist. Der italo-schweizer Autor, ein Kenner des politischen Intrigenspiels, Realität und Fiktion eng verschränkt. Dass der Roman am Schluss sich apokalyptisch entfernt, um dann doch wieder in die private Geborgenheit zurückzukehren, bleibt allerdings rätselhaft. Note: 2/3 ( ai)
>> Der „Magier im Kreml“ ist der rätselhafte, geheimnisvolle Wadim Baranow, der 15 Jahre lang engster Berater und spin doctor des „Zaren“, Vladmir Putin war. Der Ich-Erzähler verfolgte wie viele andere politischen Beobachter die wenigen bekannten Mutmaßungen über Baranows Tätigkeit, bevor er Jahre später in Moskaus Archiven zufällig auf Spuren Baranows trifft. Er beschäftigt sich nämlich mit dem Schriftseller Jewegeni Samjatin, der 1922 den hellsichtigen, dystopischen Roman „Wir“ schrieb, in dem quasi 100 Jahre Entwicklung von Gesellschaft und Technik übersprungen wurden. Unter den social media Kanälen, die der Ich-Erzähler zu jener Zeit seiner Recherchen verfolgte, war auch ein gewisser Nicolas Brandeis, ein Pseudonym, das auch Baranow benutzte. Das wusste der Ich-Erzähler allerdings zu diesem Zeitpunkt noch nicht. Er vermutete einen Studenten in einer 1 Zimmer Wohnung. Dieser Brandeis zitiert auf seinem Kanal immer wieder Samjatin. Als der Ich-Erzähler mit einem Samjatin Zitat antwortet, meldet sich Brandeis und bietet ein Treffen an. Bei diesem Treffen zeigt ihm Brandeis/ Baranow das Original eines Schreibens von Samjatin an Stalin, in dem er um Gnade und die Erlaubnis, die UdSSR zu verlassen, bittet. Für Baranow ist Stalin ein Künstler, ein Künstler allerdings, dessen „Kunst“ unweigerlich ins Konzentrationslager führt. Die erste Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts sei ein satanischer Wettstreit zwischen Künstlern wie Stalin, Hitler und Churchill gewesen. Dann kamen die Bürokraten. Aber nun seien wieder die Künstler dran. Damit wird klar, wie er Putin sieht: In der Nachfolge von Stalin und Hitler. Und er habe eine Zeitlang dessen Handlanger gespielt, sei nun aber im Ruhestand. Der Ich-Erzähler muss rasch gemerkt haben, mit wem er es zu tun hat. Im Buch selbst wird dieser Moment allerdings nicht thematisiert. In diesem raffiniert gestrickten Rahmen erfährt man schon sehr viel über die Person Baranow und seine Sicht auf die Welt im Allgemeinen und das Sowjetsystem im Besonderen. Den Hauptteil des Buches (von Kapitel 3 bis 30), nimmt dann allerdings die Erzählung Baranows über seine Zeit im Kreml ein.
Das Schöne an Literatur ist, dass man die Welt mit den Augen einer Person sehen kann, die einem nicht sympathisch ist. Da Empoli gelingt dies durch eine großartige Prosa, die psychologischen Tiefgang hat. Der „Magier“ Baranow hat Putin begleitet von seinen Anfängen als Petersburger KGB-Mann bis zu dem Zeitpunkt, an dem seine Dienste nicht mehr gefragt oder auch nicht mehr nötig waren. Seine Arbeit bestand hauptsächlich darin, den „Fluss der Wut zu steuern und zu verhindern, dass si sich staut.
Vom Auftritt des betrunkenen Jelzin in den USA, als sich Präsident Clinton vor Lachen bog und die Bilder um die Welt gingen und sich traumatisch ins russische Gedächtnis eigebrannt haben, über die Oligarchen Beresowski (Verbannung ins Exil) Chordokowski (10 Jahre Straflager) bis zu den Pyschospielchen mit Putins Labrador bei Merkels Besuch, dem Krieg im Donbas und die hybride Kriegführung : Die Ereignisse sind historisch, die Namen echt. Wir erleben dies durch die Augen eines Insiders, der bei allen Inszenierungen die Fäden zieht und der die russische Gesellschaft und Seele kennt, die Stalin verklärt und für die die mafiöse Struktur des Staates normal ist.
Ein Buch, das einen klüger zurücklässt, dazu mit überzeugender literarischen Qualität und psychologischem Tiefgang. Note: 2 ( ün) <<
>> Der Roman zeichnet die letzten 30 Jahre russischer Geschichte nach und beschreibt beeindruckend Putins („Zar“) Aufstieg. Der Ich-Erzähler wird von Wadim Baranow („Magier“) eingeladen, der Putin 15 Jahre lang beraten hat. Eine Nacht lang erzählt er über seine Beraterzeit. Baranow ist ein Pseudonym für Wladislaw Surkow.
Das System Putin: Führung und Autorität gepaart mit Skrupellosigkeit. Putin befriedigt die Sehnsucht seiner sich nach dem Zusammenbruch des Sowjetimperiums erniedrigt fühlenden Landsleute nach Anerkennung und Respekt. Nebenbei erfährt man manch Kurioses wie zum Beispiel die Hundephobie Angela Merkels oder den Namen von Putins riesigem Labrador.
Giuliano de Empoli hat bisher nur Sachbücher geschrieben. Während der Lektüre fragte ich mich, ob ein Sachbuch (etwa Michael Thumann: Revanche) „mehr“ gebracht hätte, als dieser letztlich fiktionale Text. Im letzten der 31 Kapitel steht etwas unvermittelt und idyllisch Baranows fünfjährige Tochter im Mittelpunkt.
Der letzte Satz des Buches:“Draußen fiel leise Schnee“ erinnert mich an mein liebstes Weihnachtslied und kontrastiert mit den apokalyptischen Ahnungen der beiden vorletzten Kapitel. Sie bieten schwere Kost: „Die Menschheitsgeschichte endet mit uns.“ Unerfreulich, vor allem für die nach uns. Und echt hart der Blick nach vorne: Roboter werden die Welt regieren. Das ausführliche Zitieren von Versen der Offenbarung (21,3) bleibt mir unverständlich: „Siehe da! Die Hütte Gottes bei den Menschen!“
Hoffentlich wird es nicht ganz so schlimm… Note: ( ax) <<
>> Der gebürtige italo-schweizerische Schriftsteller ist nicht nur Professor der Politikwissenschaft in Paris, sondern war auch Berater – vielleicht sogar Spindoctor – des italienischen Ministerpräsidenten Renzi. In diesem, seinem ersten Roman, ist der Hauptprotagonist Baranow Spindoctor. Der Rasputin des modernen Zaren, der Einflüsterer und Designer des aktuellen Putinismus. Tatsächlich ist die Figur dem zeitgenössischen und inzwischen in Ungnade gefallenen W. Surkow nachempfunden, der jahrelang als Magier des Zaren auftrat und die Aura um Putin dirigierte. Es ist ein Roman der politischen Innenansicht. Eine fiktionalisierte Zeitgeschichte. Ereignisse, Katastrophen und Morde sind authentische Details des Hier und Jetzt. Personen werden mit Klarnamen benannt und sind dabei glänzend in einen literarischen Gesamtwurf eingearbeitet. Ohne Zeigefinger, aber letztlich entblößend, vordergründig würdigend und hintergründig offenbarend. Seelisch-physische Gewalt des Systems wird wie ein unabwendbares Naturereignis vermittelt. Der Zar Putin profiliert sich als der, der diese Natur neu erfinden lässt. Der Erfinder voller Eifer ist Baranow.
Im Ductus ein Werk mit sprachlicher Eleganz. Man ist fast erstaunt, wie fließend es gelingt, dem schnöden Sachbuchalltag eine erkennbar leuchtende Konnotation zu verleihen. Vielleicht auch aus diesem Grund – oder gerade deshalb – verortet der Autor den Hauptprotagonisten Baranow in einer intellektuell geprägten Dynastie. Die Wände voller Bücher, die Köpfe voller Visionen. Schon die Verwandtschaft überzeugte mit literarischem Bewusstseins, das allein die russische Seele erschöpfend spiegeln konnte. In diesem Geiste offenbart sich Baranow in einer einzigen Nacht einem Fremden gegenüber und wir nehmen daran teil.
Die Rahmenhandlung ist mager und ein wenig bemüht. Der Ich-Erzähler ist Literaturwissenschaftler und Bewunderer des russischen Schriftstellers Samjatin, der tatsächlich 1920 in seinem Werk „Wir“ eine entmutigende Politpsychosystem-Analyse entwarf, die mit geradezu hellseherischem Weitblick die Verwerfungen von Stalin bis Putin vorwegnahm. Über einen Chat-Blog kommt der Ich-Erzähler mit Baranow in Kontakt. Denn auch er ist einer der wenigen Kenner des längst verstorbenen Visionärs.
Baranows Urahnen waren breitschultrige Aristrokaten. Ihr Leben war geprägt von großvolumigen Auftritten und literarischem Mitteilungsbedürfnis. Sein Vater dagegen wechselte das Genre und entwickelte sich früh zum überzeugten Apparatschik mit dem Lebenstraum von einer ehrenvollen Grabgedenkstätte. Baranow nun vereint die konträren Ahnenzüge. Kreativ, gegebenenfalls unkonventionell, loyal, zurückhaltend, analytisch, intellektuell, effizient, weitgehend emotionslos, gewissenhaft und gewissenlos.
Die russische Spezies zeichnet ein stabiler Charakter aus, der die Gesellschaften seit Jahrhunderten prägt. Eine lähmende Schicksalsergebenheit hält sie in geduckter Haltung. Gleichzeitig setzen sich Einzelne ab – vom Zaren über Stalin bis zu Putin, reißen die Macht an sich und perfektionieren die Unterdrückung. Die wirkungsvollste Form der individuellen Disziplinierung ist die grundlose Bestrafung. Sie macht ein Berechnen unmöglich, lähmt nachhaltig und verhindert die Gegenwehr. Es bleibt im Verschwommenen, wer der direkte Widersacher ist. Es ist nicht erkennbar, mit wem Verbrüderung helfend wäre. Nur eine kleine Öffnung führt von den namenlosen Massen zu den Mächtigen. Die Nähe zum Zaren ist das bestimmende Privileg. Der Weg dorthin verläuft auf Speichel, der emsig geleckt werden will.
So hatte es früher immer funktioniert bis Gorbatschow kam. Perestroika und Glasnost hießen die Gespenster bis hin zum Zusammenbruch der Parteidiktatur. Der augenblickliche Zerfall des Reiches und der schmerzliche Verlust der nationalen Identität folgten postwendend. Im nächsten Moment wurde der Systemwechsel ausgerufen als der betrunkene Jelzin den blanken Raubtierkapitalismus verordnete. Jede Form von Ordnung kollabierte. Großkopfete, die in den Wandelwirren beherzt zugriffen, eigneten sich unsägliche Reichtümer an. Die Massen dagegen verarmten noch mehr. Die Sicherheit brach zusammen und ein bestialischer Nahkampf entbrannte im Alltag. Es war unmenschlich. Dann brachte ein einflussreicher brain tank unter einem Fernsehmogul den namenlosen Putin.
Baranow ist in dieser Zeit mittelloser Schauspieler, als er Eintritt in das neu etablierte Fernsehen findet. Fernsehen – das neuralgische Herz der neuen Welt, das mit seinem magischen Gewicht die Zeit krümmte und auf alles den phosphoreszierenden Widerschein des Verlangens projizierte (S70). Die Massen verlieren über Nacht die Unterdrückung und wachen orientierungslos in einem Supermarkt auf. Die Fernsehmacher mit Baranow produzieren derweil vulgären Trash, laut und lässig. Das Leben ist frei bei völligem Kontrollverlust. Währenddessen rettet der Fernsehmilliardär Beresowski noch einmal die Wiederwahl des mental verwahrlosten Jelzin und wird selbst zum heimlichen Herrscher über Russland. Ihm schwebt ein neues, altes Russland vor. Sicherheit nach innen und Stärke nach außen. Eine Nation mit Stolz. Die Partei der Einheit wird gegründet, während der eloquente Baranow zum Kernmitarbeiter avanciert. Gemeinsam überzeugen sie den farblosen Chef des Inlandgeheimdienstes Putin, als Ministerpräsident anzutreten. Öffentlich unverbraucht, vertrauenswürdig, ausbaufähig. Nach Zögern stimmt Putin zu, Baranow wird sein engster Vertrauter. Die Grundidee lautet: die degenerierte gegenwärtige Horizontalität sei zu überwinden und die alte Vertikalität mit klaren Machtstrukturen wiederherzustellen. Gesagt, getan. Ein glücklicher – oder arrangierter? – Zufall spielt dem neu gewählten Präsidenten in die Hände. Die verheerenden Terroranschläge auf Moskauer Wohnblocks werden fundamentalistischen Tschetschenen zugeordnet, worauf Putin als entschlossener Rächer auftritt. Das ist der wahre Inthronisationsmoment des neuen Zaren. Es war schon immer viel überzeugender auf Gefahren zu reagieren, als sie im Vorfeld zu verhindern. Mit Gewalt gewinnt die Vertikale augenblicklich an Überzeugungskraft.
Putin baut die Strukturen radikal um. Köpfe rollen. Patriotische Silowiki der Sicherheitsdienste bilden die neue Elite. Privilegien werden neu vergeben. Oligarchen dürfen walten, wenn sie dem System nützlich sind. Von der Politik müssen sie sich jedoch fernhalten. Beresowski will genau das nicht wahrhaben. Beim Untergang des russischen Atom-U-Bootes in der Barentsee zwingt er Putin den Urlaub abzubrechen und an einem vom Fernsehen arrangierten Treffen mit den Müttern ertrunkener Matrosen teilzunehmen. Putin, der niemanden mehr über sich duldet, zieht Konsequenzen. Der Fernsehmogul verliert seinen Sender, muss das Land verlassen und wird später in seinem Londoner Exil erhängt aufgefunden.
Auch Baranow ist konspirativ unterwegs, trifft allerlei Außerparlamentarische, Jugendbewegte, Rechtsradikale, Rocker, Spinner vieler Richtungen. Alles Suchende, denen er Unterstützung organisiert und das neue patriotische Weltbild unterjubelt. Dabei gesteht er: Ich hatte in meinem Leben nichts anderes getan, als die Elastizität der Welt, ihre unerschöpfliche Neigung zu Paradoxien und Widersprüchen zu vermessen (173). Das um Putin inszenierte politische Theater ist die krönende Vollendung dieser Tätigkeit. Auf der anderen Seite müssen Transgender-Getriebene, Ökofundamentalisten und in Kathedralen obszön auftretende Frauenbands nicht berücksichtigt werden, da die Empörung der Öffentlichkeit ob dieser Querulanten der autoritären Obrigkeit von allein Punkte einbringen. Ansonsten gilt im In- und Ausland das Konzept gegenseitiger Neutralisierung. Man fördert gegeneinander opponierende Parteien, damit sie gestärkt sich gegenseitig niederringen. Black Panther versus Suprematics. Tierschützer versus Jäger. Darüber hinaus generiert sich reale Macht schon allein durch die irreale Angst vor ihr. Entsprechend hilfreich ist es, wenn der Westen meint, dass der Osten sie mit Fake News flutet und ihre IT Systeme unterläuft. Nächtliche Fantasien lassen das Chaos aufblühen. Mission completed.
Doch als der ihm fragwürdig erscheinende Ukraine Krieg inszeniert und Baranow auf alle internationalen Sanktionslisten gesetzt wird, bleibt Baranow als Gefangener seiner selbst und seines Landes deprimiert zurück. Er quittiert seine langjährige Tätigkeit im Schatten des Zaren und wird Privatier. Putin wird ihn nicht ersetzen. Der Zar lebt jetzt nur noch aus sich selbst heraus.
Neben den eingestreuten politischen Episoden (Clintons Lachkrampf über Jelzin, Merkel im Kreml mit Hund, Winterolympiade im subtropischen Sotschi etc.) lässt der Autor auch gelegentliche Emotionen im gefühlsarmen Baranow aufflammen. Zündfunke ist die schillernde Schönheit Xenja, die ihn anhaltend in Bann hält und letztendlich seine späte Tochter Anja, die allein ihn zu einem anderen Menschen verzaubert. Bemerkenswert ist die Intensität dieser Passagen, die auch dem Verdacht widerstehen, kitschig zu sein. Selbst diese sind gelungen.
Am Ende des Werkes legt der Autor da Empoli Baranow eine düstere Prognose in den Mund: die Welt werde mit den – vor allem vom Westen – vorangetriebenen IT Instrumenten die Menschheit in den Ruin dirigieren. Bereits das unschuldige Geschöpf Anna wird diesem Niedergang zum Opfer fallen. Diktatorische Maschinen werden die Gewaltherrschaften lebender Diktaturen perfektionieren und diese verdrängen. Auch wenn das Erzählfinale etwas entglitten daherkommt, bleibt das Gesamtwerk eine erhellende Lektüre der russischen Postmoderne ohne als trockene Systemanalyse des Putinismus zu langweilen. Note: 2– (ur) <<
 Siedler 2014 | 224 Seiten
Siedler 2014 | 224 Seiten
>>Bartholomäus Grill hatte wahrlich viele Begegnungen mit dem Tod. Großeltern, Eltern, Schulfreunde, die kleine Schwester, der Bruder, vor allem aber durch die vielen Jahre als Kriegsreporter bei den schlimmsten Schlächtern in allen Regionen der Welt. Der tief verwurzelte katholische Glaube seiner oberbayrischen Heimat, in der der Tod und die Verdammnis, aber auch Hoffnung allgegenwärtig sind, tut ein Übriges.
Nach seiner berührenden Reportage in der ZEIT über den selbstgewählten Tod seines krebskranken Bruders in der Schweiz hat ihn der Verlag offensichtlich zu diesem Buchprojekt angeregt, wie man der Danksagung entnehmen kann. Eine lohnenswerte Lektüre, wenn auch die oberbayrische Prägung des Katholizismus etwas viel Raum einnimmt. Beeindruckend das Streitgespräch mit dem Moraltheologen Spaemann über den Freitod. Wie sich Grill zwischen der These: „Denke an nichts so oft wie den Tod“ (Seneca) und der Antithese: „Ein freier Mensch verschwendet keinen Gedanken an den Tod“ (Spinoza) entscheidet, bleibt offen. Vielleicht gibt es eine Synthese. Note: 2 – (ün)<<
>> Grills eindrucksvolle Begegnungen mit dem Tod sind auch Auseinandersetzung mit den eigenen Erinnerungen. Die eigene Kindheit (glücklicherweise frei vom Unterwerfungsritual religiöser Dogmen) Abschied von Großeltern, Pubertät (Film Massenmord Auschwitz), vor allem Grenz- und Todeserfahrungen während der Studentenzeit (Existenzialismuspose, Revolutionsromantik, auch Verirrungen und Verwirrungen), Abschied von Eltern und jüngst von wichtigen Freunden und Freundinnen. Vor allem wenn Grill im doppelten Sinne in der Nähe bleibt (Familie, die Libeth- Rosalie-Episode etc.), nimmt er den Leser mit . Seine Erfahrungen als Auslandskorrespondent über die Massenmorde und Massensterben bringen angesichts der vielfach bekannten traurigen Fakten wenig Erkenntnisgewinn und berühren nur dann, wenn aus dem Kollektiv der Bestialität das Einzelschicksal sichtbar wird. Für mich zentral ist Urbans „assistierter Freitod“ und die Auseinandersetzung mit Robert Spaemann, ein Dialog auf Augenhöhe und hohem Niveau, im Ergebnis offen. Anders als bei Grill in seinem Schlusskapitel bestimmt meine innere Vorstellung des Reichs der Toten keine Winterlandschaft. Mein Wunsch ist ein Wärmestrom von Erinnerung. Note: 1,5 (ai) <<
>> Verglichen mit dem Autor habe ich in meinem bisherigen Leben deutlich weniger Begegnungen mit Sterbenden und Toten erlebt. Habe ich Glück gehabt?
Auch nach längerem Nachdenken fällt mir „nur“ der Tod meiner Großmutter Kreszentia im Frühsommer 1964 ein, in deren Haus wir wohnten. Die ganze Familie stand betend um ihr Bett, ein Pfarrer brachte die „Letzte Ölung“ (heute freundlicher Krankensalbung genannt). Die Pausen zwischen den gequälten Atemzügen wurden immer länger…
Die Argumentation des Moraltheologen Robert Spaemann finde ich unbarmherzig.Die Interpretation des Liedes vom „Major Tom“ durch den Autor ist etwas daneben. Hingegen sein Satz „Wir Journalisten sind fehlbar“: einfach großartig. Vergleichbares liest man sehr selten.
Ein beeindruckendes Buch, das mich mehr als andere Bücher bewegte und Gefühle auslöste, die ich schwer in angemessene Worte fassen kann. Note: 1,5 (ax)<<
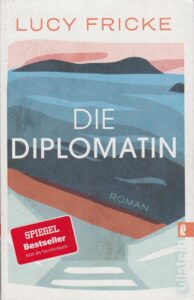 Ullstein, 2022 | 254 Seiten
Ullstein, 2022 | 254 Seiten
<< „Die Diplomatin“ ist die Ich-Erzählerin Friederike Andermann, genannt Fred. Sie ist Botschafterin in Montevideo und schiebt dort eine ruhige Kugel, bis die Entführung und Ermordung einer deutschen Touristin, Tochter einer mächtigen Verlegerin, alles durcheinander wirbelt. Sie wird in die „Zentrale“ zurückbeordert. Zwei Jahre später kommt sie als Konsulin nach Istanbul, wo die diplomtischen Geschäfte heikler und schwieriger sind. Die Inhaftierung von mißliebigen Journalisten und Regimegegnern mit Verbindungen nach Deutschland binden alle Kräfte, auch die des Botschafters Philip, einem alten Freund von Fred. Die willkürlichen Verhaftungen und Prozesse sind nicht wirklich was Neues für den Leser, die diplomatischen Fäden und Überlegungen im Hintergrund schon. Die Autorin hat Insiderwissen und gut recherchiert. Wird der Diplomatenalltag im ersten Teil „Montevideo“ noch sehr witzig, unterhaltsam und sprachlich gekonnt geschildert, verflüchtigt sich das im zweiten Teil „Istanbul“ zusehends und wird deutlich flacher. Vieles ist vorhersehbar.
Schließlich entschließt sich Fred gegen den ausdrücklichen Rat von Botschafter und Freund Philip, drei von der Polizei gesuchte oder zumindest mit Ausreiseverbot belegten Dissidenten im selbstgesteuerten Auto (Philip: „Niemals das Auto selbst steuern“) zur Südküste zu fahren und zur Flucht nach Griechenland zu verhelfen. Unzweifelfhaft das Ende ihrer Karierre, was allerdings offenbleibt. Im letzten Kapitel
„Hamburg“ besucht sie ihre Mutter im Krankenhaus, die kurz zuvor aus einer brennden Küche gerettet werden musste. Die von der Feuerwehr aufgebrochene Wohnung weckt Erinnerungen von Fred an ihre früheste Kindheit im Osten, als sie die Wohnung und das Land auch pötzlich verlassen mussten. Ihre Mutter weiß auch nicht mehr viel, was der Grund war. „Geheimdienst, oder so“.
Das Ende wirkt reichlich konstruiert. Note : 3 ( ün) <<
>> Ja, die ersten Kapitel sind vielversprechend. Was uns die Ich-Erzählerin Friederike Andermann als neue Botschafterin in Montevideo mitteilt, führt in die kleine große Welt der Diplomatie. Zwischen Bratwürstchen-Einheitsfest, Krisenmanagement und Bettkante bewegt sich die inzwischen 50-jährige Protagonistin. Das jugendliche Latzhosenmädchen, Tochter einer alleinerziehenden Kellnerin, aufgewachsen im Hamburger Arbeiterviertel, Jurastudium, einen „Fast-Ehemann“, zwei Fehlgeburten, jetzt eine selbstbewusste Frau, die „auf den Wunsch nach Ehe und Familie keine Antwort wusste“, eine Karriere auch durch späten Quotenvorteil, Heimatbezug durch Mutters Holsteiner Schinken, die Alltagserfahrung eines Lebens zwischen Privatheit und Öffentlichkeit, Stationenhopping im diplomatischen Dienst, Bagdad, Montevideo, Zentrale, Istanbul, all das wäre Stoff für eine großartige Geschichte gewesen. Und gerade Freds Sozialisation ermöglicht auch großartige Einblicke in diplomatische Verkehrsformen: Repräsentationsrituale, Sprachregelungen (CYA), Verhaltensmuster zwischen der Zentrale und den Außenstellen, brillante Charakterisierungen von Partnerbeziehungen im diplomatischen Dienst (köstlich nicht nur der MAP), Aufstieg einerseits, Verkümmerung anderseits, Altersruhesitz Südfrankreich oder Uckermark, ein Schmankerl die Leopardenfell-Prüfung oder in Ankara die „Honigdiplomatie“! Stattdessen rücken zunehmend Spannungspotentiale ins Zentrum. Die Stärke der Montevideo-Episode liegt im exemplarischen Detail: Ein Polizeipräsident-Macho wie Hector, Vertraulichkeit zwischen Alkohol und Mate-Tee, Gastgeschenk Solartaschenlampe, die Nazienklave und das kärgliche Eventmanagement einer deutschen Botschaft zum Jahreshighlight deutscher Wiedervereinigung, all das atmosphärisch dicht und sprachlich gekonnt. Doch dann tischt die Autorin auf, was das Unterhaltungsgenre fordert: Drogendealer entführt Tochter einer einflussreichen deutschen Zeitungsverlegerin, will Kontakt zu seinem in Deutschland lebenden Kind erpressen, dreht durch, ermordet Tamara Büscher. Die logische Folge Aktionismus im Krisenstab der Zentrale, natürlich auch das BKA involviert, da der Druck der Zeitungszarin groß. Am Ende steht zwar nicht die von ihr geforderte Schließung der Botschaft, aber die Versetzung Freds in die Zentrale. Dass Montevideo dann auch noch auf Anweisung „der Büscher“ das kurzfristige Aus für einen Journalisten und „Partyschreck aus Uruguay“ (85) bedeutet (zurück in die Lokalredaktion), ermöglicht jene Istanbuler Fred-Daniel-Beziehungsgeschichte, die zum schwächsten Teil des Romans führt. Zentral dagegen die politische Botschaft der nachfolgenden Handlung, die die aktuelle Situation der Presse in der Türkei beleuchtet. Willkürverhaftungen, Informationskanäle des türkischen Geheimdienstes (MIT), Investigativ-Journalismus unter Lebensgefahr, die Strukturen eines korrupten Justizapparats am Beispiel der Meral-Baris Geschichte. Aber eigentlich für die informierten Zeitungsleser auch nichts Neues. Hier werden Fred als Konsulin in Istanbul und Philipp als Deutscher Botschafter in Ankara, zu empathischen Akteuren, die gar die Grenzen der Diplomatie sprengen. Für mich mit dem happy-end einer doch recht platten Fluchthelfergeschichte etwas zu viel des Guten. Doch damit nicht genug: Die Schlusskapitel mit dem Schauplatz Hamburg präsentieren ein privates Wiedervereinigungspathos (Mutter, Tochter, Daniel), bei dem zu wünschen gewesen wäre, dass die Fernbedienung bei der Übertragung des Tags des Deutschen Einheit versagt hätte. Dann hätten wir auch nicht erfahren müssen, dass Schwarzrotgold jetzt nur noch schlapp weht statt knattert.
Die Entschlüsselung des doch recht kryptischen Stasi-Geheimdienstbezugs gelingt vielleicht einem mir bekannten Leser durch die ihm vertraute Kontaktaufnahme mit der Autorin. Note : 3 – ( ai) (schade, der „Roman“ hätte Potential)<<
<< Die Diplomatin ist Fred, eine maskulin harsch bestückte Friederike. Karrierebewusste Botschaftermentalität mit steter Sicht auf die Berliner Zentrale. Anfänglich Montevideo, Uruguay. Das Land, in dem die Friedlichkeit die Gedanken zum Erliegen bringt. Die Restsedierung erfolgt im Mekka der Rindersteaks durch den über allem schwebende Grillkohlestaub. Goethe und seine Statuen werden hier nicht gehuldigt, sondern nur von Hunden bepinkelt. Freds Aufgabe erschöpft sich darin Deutschland zu sein. Zum Tag der Deutschen Einheit kontert sie vorschriftsmäßig mit dem legendären Kulturhöhepunkt: Bratwürste urdeutscher Machart. Doch dann wird ein deutsches Verlegermädel ermordet, man kann nichts tun, Fred wird versetzt, mausert sich später zu einer innerlich bewegten Fluchthelferin als Konsulin in Istanbul und trifft letztendlich im Halbschatten der alternden Mutter in Hamburg einen David, den sie – ergänzend zu ihrem zweiten Ehemann – liebhaben kann. Dann ist fertig. Dazwischen erheiternde Passagen einer kaltschnäuzigen Mannsfrau , die zur Fraufrau wird. Satirisch-reale Einblicke in Diplomatiefacetten, türkische Staatswillkür und über allem die wenig geglückte Metamorphose-Darstellung eines gefühlsarmen Weibes, das zum teilempathischen Charakter changiert. Zwar ist der Leser der Protagonistin stets auf den Versen, doch wird es ihm schwer gemacht, ihre handwerklich dürftig in Szene gesetzten Entwicklungen nachzuvollziehen.
Fred ist 50, beginnt gerade in Uruguay Netzwerke aufzubauen, als die extrovertierte Tochter der einflussreichsten deutschen Verlegerin von einem polizeibekannten Kleinkriminellen entführt wird. Er möchte seine in Deutschland bei der getrennten Ehefrau lebende Tochter sehen. Liebe macht unberechenbar. 200 km weiter findet man Tage später die Leiche der Verlegertochter – jedoch ohne eine Spur des Täters. Die Medien sind voll von der Tat, Fahndungsmisserfolgen und nationaler Rufschädigung. Der Tourismus bricht ein. Die deutsche Botschaft gerät in einen desaströsen Abwärtsstrudel. Zur Stimmungsaufhellung wird Fred zwei Jahre in das Berliner Krisenzentrum versetzt, wo sie in abgedunkelten Räumen auf Tsunamis, Vulkaneruptionen und Bürgerkriegsausbrüche wartet, um deutsche Staatsbürger evakuieren zu können.
Die Wiederauferstehung von Fred als Konsulin wird in Istanbul inszeniert. Unzählige Oppositionelle sind der Erdogan Justiz bereits zum Opfer gefallen. So auch die deutschkurdische Historikerin Meral. Seit Monaten in Untersuchungshaft versucht deren deutscher Sohn Baris sie zu besuchen, gerät jedoch sofort in die Fänge des Polizeistaates. Ein Ausreiseverbot wird verhängt. Zusammen mit dem deutschen Botschafter aus Ankara, dem diplomatischen Justizveteran Christof und einer nahkampferprobten Rechtsanwältin zeigt man hektische Präsenz beim Prozess gegen Meral. Überraschend wird sie – auch bedingt durch das große Medieninteresse – freigesprochen. Verdeckt soll sie sofort abgeschoben werden. Am Flughafen gelingt es gerade noch, desorientiertes Wachpersonal von ihrer Freilassung zu überzeugen. Nun gerät der Plot irgendwie ein bisschen albern – aber schön, dass alles noch einmal gutgegangen ist.
Um einen Zusammenhang zum isolierten Uruguay Abschnitt herzustellen, muss schließlich der Reporter David wieder auftauchen, den Fred bereits in Montevideo als Abgesandten der rachesüchtigen Verlegerin kennenlernte. Statt Angst provoziert die Begegnung diesmal jedoch Liebe. Gegen später werden beide sich im gegenseitigem Einverständnis die Kleider vom Leibe reißen. Aber ach! Der noch lahmende Spannungsbogen soll noch einmal nachgeschärft werden, weshalb jetzt auch David ins Visier des türkischen Staatsschutzes geraten muss. Seine Wohnung wird durchsucht und verwüstet. Fred gewährt ihm im Konsulat Unterschlupf, Pizzahälften und sanfte Berührungen. Mit einer Prise Emotionen verschnauft das Geschehen, holt dann aber zum finalen Paukenschlag aus: die Putzfrau vermittelt einen Enkel, der mit seinem kleinen Motorboot Meral, Baris und David von der türkischen Küste zu einem rettenden griechischen Eiland schippert (3 km Luftlinie). EU-Land, Freiheit, Rechtstaatlichkeit. Ein liebliches Episodenende. Geht doch.
Zu guter Letzt dann noch was ganz Persönliches. Die betagte Mutter von Fred ist gestürzt. Fred eilt also zügig heim, trifft in Hamburg erneut David – auch ins Herz. Und wird von dessen Verlegerin freundlich gegrüßt. Selbst Rache kann in diesem Setting zuverlässig befriedet werden.
Nur eine Frage bleibt offen: Warum wird im Roman nicht auch mal Sauerkraut gegessen? Note: 3 – (ur) <<
>> Montevideo. Im ersten Satz des Romans „knatterte die deutsche Fahne im Wind.“ Im letzten Satz in Hamburg „wehte schlaff die deutsche Fahne im Wind.“ Ein windiger Wink der Autorin Lucy Fricke für die Einordung des Romangeschehens? Ich bin nicht sicher, was sie gemeint haben könnte. Die Autorin gewährt uns überzeugende und tiefe Einblicke in den diplomatischen Alltag, schreibt mit Humor und trockener Ironie, der besonders in den zahlreichen Dialogen besticht. Da spielt sie in einer ganz anderen Liga als zum Beispiel unser letzter Autor Fitzek (Elternabend).
Die „diplomatische“ Taktik „Cover your ass“ (CYA) findet sich allerdings nicht nur im Diplomatischen Dienst. Die enge Zusammenarbeit zwischen türkischen und deutschen Geheimdiensten finde ich skandalös. Leider muss man davon ausgehen, dass hier nicht übertrieben wird. Mesale Tolu hat diesbezüglich im Weltethos-Institut über ihre Inhaftierung in der Türkei berichtet. Vielleicht hat ihr Fall die Autorin auch etwas inspiriert.
Zum Schluss ein paar Sätze, die mir besonders gut gefallen haben:
„Es gab Liebe, die war so rational, dass sie durch nichts zerstört werden konnte.“ (S.22) Der Satz bezieht sich auf Ehepaare im Diplomatischen Dienst.
„Deutsche Touristen waren ein Elend.“(S.27).
„Wer die höchste Strafe verhängt, steigt auf.“ (S.125) Über die türkische Justiz.
Insgesamt ein spannendes und lohnendes Buch, auch wenn der Schlußteil etwas aufgesetzt rüberkommt. Note : 2+ ( ax) <<
 mikrotext 2022 | 213 Seiten.
mikrotext 2022 | 213 Seiten.
>> Ein anatolisch deutscher Mikrokosmos, der 1965 mit dem neuen Leben Fatmas beginnt. Zwangsheirat mit dem „riesigen Kopf“ Yilmaz, er lebt schon in Deutschland. Dort „wo man das Geld von den Bäumen pflücken kann“ gilt es für Fatma auch den Weg für die beiden zurückgebliebenen (!) Brüder zu „pflastern“. Die Geschichte, die jetzt beginnt, wird uns im Wesentlichen in einer dialogischen Perspektive von Dincer und seiner Mutter erzählt. Was sich in der fremden neuen Heimat in Nettetal dann abspielt, ist sicherlich auch ein typisches Familiengenerationenschicksal türkischer Gastarbeiterfamilien, das zugleich die gesellschaftlichen Spannungspotentiale aufzeigt („Solingen brennt“), dem der eloquente Dincer in eindrucksvollen Bildern seine Sprache verleiht. Im Zentrum jedoch steht eine Mutter-Sohn-Beziehung. “Unser Deutschlandmärchen“ ist vor allem eine Hommage an Fatma. Die Schauplätze sind Fabrikhallen, Spargelfelder, Putzdienste im Kneipen- und Bordellmilieu (Doppelbödigkeit männlicher Familienehre!), ein schuldengeplagter Alltag, aufopferungsvoll, jährlich gabenreiche Pflichtbesuche nach Anatolien mit Rückfall in alte Rollenmuster. Yilmaz, Ehemann und Vater ein Totalausfall, ein spät erfüllter Kinderwunsch und dann die Hoffnung, dass Sohn Dincer als Mannersatz zur „zweiten Chance in ihrem Leben“ werden würde. Was die Pflichten anbelangt, werden diese Erwartungen zunächst auch erfüllt. Das Arbeitsethos des Kindes bewundernswert. Dass dann allerdings nicht der „Blaumann“ und wie bei Fatmas im klassischen Sinne erfolgreichen Brüdern das zweite Haus im Heimatland in Erfüllung gehen, sondern sich schon früh bei Dincer in vielfacher Hinsicht eine Gegenwelt auftut, bleibt der Mutter fremd. Bohème statt Drehbank, Lyrik statt Stechuhr, nach anatolischen Kategorien kein Mann sondern schwul, kein von der Oma gewünschter „Hodscha“ sondern ein 14jähriger, der in der Nettetaler Moschee die leerformelhafte Inszenierung der Koranlesungen durchschaut und nicht mehr bereit ist in dieser Zeremonie die Marionette zu spielen. Die Stärke des Buches liegt gerade darin diesen Entwicklungs- und Abnabelungsprozess, der sowohl bei Fatma und Dincer auch Schuldgefühle hinterlässt, eindrucksvoll zu erzählen.
Dem Amtsrichter Hoeke (ironischerweise ist Schuldnervater Yilmaz der Weichensteller), der dieses Buch letztlich erst möglich gemacht hat, wäre allerdings zu empfehlen gewesen, es mit dem literarischen Kanon für den jugendlichen Dincer und den späteren Heidenreich-Walser Connections etwas behutsamer angehen zu lassen. Der ganze formale und inhaltliche literarische Überbau (Gebet, Lied, Chor, Bühnendialog, Lyrik etc.) dieses Buches ist eher verstörend, weil er den eindrucksvollen Klartext dieses Familienschicksals trübt. Note: 2/3 (ai)<<
>> Das Realmärchen des Deutschtürken Güçyeter gibt sich als literarisches Experiment. 70 Episoden. Überwiegend Prosa, gelegentlich Lyrik. Einer gebrochenen Chronologie folgend erzählen der Autor und seine Mutter von anatolischer Heimat, deutscher Nicht-Heimat, schmerzhaften Traditionen, ekelhafter Männerherrschaft, Befreiungen und Gefangenschaft. Erheiterndes und Erschütterendes. Es funktioniert erstaunlich gut, ein und dieselbe Geschichte aus dem Munde von Mutter und Sohn zu hören. Es funktioniert erstaunlich gut, wie die große Zahl von Mosaiksteinen sich zu einer eindrücklichen Familienbiographie verdichtet. Es funktioniert, den Anklagen überzeugendes Gewicht zu geben, sind sie doch eingeflochten in das Gewebe belasteter Lebensläufe. Und daneben leuchtet dennoch Freude und Frohsinn auf.
Unser Deutschland Märchen reflektiert das individuelle Schicksal einer Gastarbeiterfamilie aus dem archaischen Anatolien in der industriell explositionsartig expandierenden Bundesrepublik. Der Roman durchleuchtet die Emanzipationsversuche des Autors als feingeistigen Einzelgänger gegenüber der rechtschaffenden Mutter. Die Befreiungsschläge der Frau in der Männer-dominierten Unendlichkeit. Die Fesseln und Widersprüche eines hochfrequenten Wirtschaftssystems im Kontrast zu lähmenden Gesellschaftsnormen in der jährlich besuchten türkischen Heimat. Es ist auch eine Sozialreportage der Wirtschaftswunderjahre.
Fatma ist die Mutter von Dinçer. Deren Mutter lebte noch als Nomadin von den Einnahmen ihres Tabak-schmuggelnden Mannes – bis er erschossen wurde. Die Regeln dieser Gesellschaft lesen sich so: „Ein obdachloses Weib zu behüten, ist die Pflicht eines jeden Mannes. Jetzt warteten … die nächsten auf sie, mit ihren steifen Werkzeugen. Bekamen die Möglichkeit, das Gewissen ihrer Schwänze zu beruhigen.“ Fatma und zwei Brüder werden gezeugt. Fatma wird einem Fremden als Gattin zugewiesen, um in Deutschland Geld für die beiden behinderten Brüder zu verdienen. Fatma will es nicht, muss es aber.
Der neue Ehemann wird sich als arbeitsscheu und wenig geschäftstüchtig erweisen. Fatma dagegen wird sofort die treibende Kraft der Familie. Hilft ihrem Mann in seiner schlecht laufenden Kneipe, quält sich mit seinen immer weiter auftürmenden Schulden ab. Arbeitet in Schwermetallfabriken, gebärt zwei Söhne und nimmt Zweittätigkeiten in der Landwirtschaft an bis der Zusammenbruch eintritt: ein schwerer Arbeitsunfall zwingt sie zu monatelangen Krankenhausaufenthalten und wiederholten Operationen, die ihren Gesundheitszustand fortlaufend verschlechtern. Und dennoch gibt sie nicht auf. Kommt den unstillbaren Begierden nach Konsumartikeln ihrer Verwandtschaft in der Türkei nach, versorgt bis zu acht Bewohner in ihrer kleinen Wohnung und beherbergt undankbare Flüchtlinge. Überraschend bewahrt sie sich ein offenes Herz. Sie kann gar nicht anders. Ein kleinwüchsiger Türke, der den Arsch nah am Boden trägt, eröffnet ein Bordell. In ihrer Kneipe verteidigt Fatma die kleinen Huren vor den sabbernden, geilen Böcken und versucht die jungen Dirnen wieder auf den rechten Pfad zu leiten. Sie werden in ihren wankelmütigen VW-Bus verfrachtet mit Ziel Frankfurt, Köln oder wo immer die Mädchen herkommen. Ihre Väter und Brüder werden bedrängt, die verstoßenen Töchter wieder aufzunehmen. Meist klappt es nicht. Dinçer wird später ihr Lebensgefühl so beschreiben: „Das hier ist nicht mein Leben. Das hier ist nur die Zeit, in der ich die Töpfe der anderen fülle…“.
Dinçer ist Fatmas lang ersehnter Erstgeborene. Er ist besonders, integriert sich kaum in den deutschen Kinderalltag, schreibt früh Gedichte. “Wenn ich vor meinen schönsten Jahre sterbe, soll keiner weinen.“ Das Testament, bereits mit acht Jahren verfasst. Dinçer leidet mit der Mutter, vernachlässigt die Schule, um schon als Grundschüler mit und für die Mutter Geld zu verdienen. Von den ersten Ersparnissen kauft er ungefragt für sie Stöckelschuhe. Leider passen sie nicht. Die Mutter trägt sie trotzdem bis die Blasen platzen. Dem Pubertierenden wird vom Onkel ein Putzjob angetragen. Auch er hat inzwischen ein Bordell eröffnet. Obwohl die versprochene Entlohnung nie gezahlt wird, fühlt Dinçer sich mit dem Erfahrungsschatz königlich entschädigt.
Das Verhältnis zur Mutter nimmt zusehends Schaden, wird zwiespältig. Er erfüllt nicht ihre Erwartungen. Sie auch seine nicht, als sie in der anatolischen Ferne die paternale Diktatur der Dörfer mitlebt. In Anatolien sind nicht Taten ein Verbrechen, sondern das Sprechen über die Taten. Also schweigt Fatma auch dann noch als eine rechtschaffende Frau geächtet wird, weil sie vor dem Missbrauch flüchtet. Dinçer macht die harte Schule einer Werkzeugmacherlehre durch. Irgendwie will er auch normal sein – und wird es doch nicht. Versucht sich bei einer Schauspielschule, fühlt sich als Schwuler entlarvt. Flüchtet von Zuhause, vagabundiert durch die Strichernächte Istanbuls. Verweigert sich. Wird dichtender Kneipier. Die Lyrik nimmt immer mehr Raum ein, auch wenn es die Familie verstört. Bis ein Herr Hoeke seine Begabung entdeckt und Dinçer nachhaltig fördert. Erste öffentliche Auftritte folgen. Die Presse berichtet euphorisch. Preise werden überreicht. Schließlich der literarische Gabelstaplerfahrer und Inhaber eines kleinen Eigenverlages. Bis heute. Das ist Dinçer Güçyeter.
Währenddessen kämpft Fatma und fügt sich dennoch dem Diktat ihres Schicksals. Und dies, obwohl sie angefüllt ist von tiefster Enttäuschung. Ihre Erfahrung ist: solange der Mensch das Dasein prägt, wird die Welt nicht für Menschen sein. Der Mensch bleibt das ewig blutende, rohe Fleisch. Egal ob in der Heimat oder Heimatlosigkeit, unter Türken oder Deutschen, in der Familie oder allein. Gerade wegen dieser abgründigen Tiefen berührt es umso mehr, wenn wir von Sohn und Mutter ein gemeinsam verfasstes Deutschland Märchen lesen. Es ist eine Heimkehr. Das sanfte, ehrliche Aufarbeiten, das Zusammenführen von Welten, von Werten, die so lange unvereinbar schienen, hatte die Mutter sich doch einen geschäftstüchtigen, starken Gattenersatz erhofft. Stattdessen brachte Dinçer sanfte Worte nach Hause. Jetzt erlebt die Mutter vermutlich zum ersten Mal als Koautorin die Stärke des Wortes durch den Mund ihres Sohnes. Ein wahres Märchen mitten in Deutschland.
Auch wenn das Werk zum Ende Gefälle offenbart, bleibt es eindrücklich.
Note 2 –(ur)<<
>>Mit der Frage „Wann wirst du dein eigenes Lied singen, Alamanya ?“ endet das „Lied der Mütter vor dem Parlament.“
Ich habe versucht, die Frage zu beantworten und angefangen zu dichten und zu singen. Den Titel „Das Brummeln der Kartoffeln“ hatte ich schnell gefunden, aber der Rest ist leider ziemlich misslungen, weshalb ich m e i n Lied der geneigten Leserschaft ersparen möchte. Vorsichtshalber habe ich es zerrissen. Die Mahnung von Mutter Fatma an ihren Sohn Dinçer gilt nicht für meine Zeilen: “Dinçer, sei nie zu schnell mit deinem Urteil, weder jetzt noch später. Die Wahrheit bleibt oft ein Geheimnis.“ Hut ab vor Dinçer G., einem Autor, der die zweite Grundschulklasse wegen mangelnder Deutschkenntnisse wiederholen musste und jetzt Prosa, Lyrik und mehr veröffentlicht. Genreübergreifend. Er spielt mit der Sprache, wirkt aber manchmal artifiziell, manieristisch. Und manchmal so anspruchsvoll, dass der native speaker nur mit Mühe versteht, was ihm der Autor sagen will.
Der Mutter-Sohn Dialog berührt durch seine Ehrlichkeit und seine Authentizität. Dinçrt enttäuscht die Erwartungen der Mutter auf einen soliden Sohn an der Werkbank. Eigentlich ein klassischer Konflikt, Kinder erfüllen nicht die Erwartungen der Eltern. Wohltuend für meine Kartoffelseele, dass Dinçer Güçyeters Deutschlandbild sich nicht auf rassistische Anschläge beschränkt, sondern auch die Unterstützung und Hilfe erwähnt, die er von deutschen Nachbarn erfahren hat.
Eine bewegende Lektüre. Lohnend. Note : 2/3 (ax) <<
<< Unser Deutschlandmärchen: Eine formal ungewöhnliche Montage aus über 60 Szenen, Gedichten, Chören, Gebeten, ja offenbar authentischen Fotos aus dem Familienalbum. Die an vielen Stellen sehr berührende Geschichte einer Einwandererfamilie aus Anatolien, die -so lässt sich vermuten- die Geschichte des Autors und seiner Familie, ist. Dinçer Güçyeter gibt auch seiner Mutter Fatma eine Stimme, in dem er zahlreiche Szenen aus ihrer Sicht erzählt. Die Frauen halten den Laden zusammen. Männer kommen eher schlecht weg bei Gücyeter. Sein Vater ist ein Versager mit „riesigem Kopf“, sein Onkel betriebt ein Bordell, in dem auch der junge Dincer aushilft. Die Männer in den Kneipen geile Böcke. Einzig Amtsrichter Hoeke- ausgerechnet- hebt sich von der negativen Folie ab. Er hilft dem 14-jährigen Dincer und erkennt sein Talent als Dichter und fördert ihn. Ein Märchen.
Im zweiten Teil wird das Buch schwächer. Zuviel gewollt und überfrachtet. Schade.
Note: 2/3 (ün)<<
 Droemer 334 Seiten.
Droemer 334 Seiten.
>> Wer seine Hauptfigur mit einer Sprache auf Kalauer- und Männerwitzniveau ausstattet, der darf sich nicht wundern, dass das eintrifft, was jener Sascha Nebel selbst vermutet:“…dass nahestehende Personen meine Gedankengänge manchmal nervtötend finden“ (81). Hinzu kommt, dass das Potpourri des sonstigen Personals kaum übers Klischee hinauskommt. Damit verspielt der Autor alles, was gute Unterhaltungsliteratur ausmacht. Ja, ich habe mich bei einigen Slapstick-Szenen im Schilfwerder-Kammerspiel auch beim Lachen ertappt, im Nachhinein ein Fall fürs Fremdschämen. Im seichten Gewässer der Handlung wird es dann unerträglich, wenn Tragisches und Ernsthaftes zum Kitsch verkommt.
Die Misere beginnt schon vor dem 1. Kapitel. Dem dümmlichen Lesehinweis des Verlags ist eine wohl humorvoll gemeinte Widmung vorangestellt: „Für meine Kinder“. Ein Warnhinweis für Leser wäre angemessener gewesen. Note 5/6 (ai) <<
>> Sebastian Fitzek, Deutschlands erfolgreichster Autor, liest man auf dem Buchdeckel. Wer wird da mäkeln wollen. 15 Millionen verkauft, tja. Er verzichtet auf die Genderei, dankt seinen Lesern auf der letzten Seite fürs Lesen und nennt seine Mailadresse. Das kommt selten vor. Kurzgefasst zum Buch: die Zettelkästen, in denen der Autor seine Pointen stapelt, müssen riesengroß sein. In einem recht konstruiert wirkenden Plot hechelt man von Pointe zu Pointe. So ähnlich wie bei manchen Kabarettisten, wo der nächste Witz vorhersehbar ist. Witz komm raus, Du bist umzingelt.
Die Penisfixiertheit („ein mir sehr wichtiges Körperteil“) langweilt. Peinlich der Hinweis auf ein Handbuch “Suizid-Verhindern für Dummies“. Da hilft auch der „Hinweis für mitlesende Oberstudienräte“ nicht weiter. Der Verlag wirbt für eine „Komödie mit Tiefgang“. Die Tiefe erschließt sich mir nicht. Der Erfolg des Buches stimmt nachdenklich. Sehr nachdenklich.
Offen blieb die Frage, warum nie geraucht wird. Das Büro des Autors (fitzek@sebastianfitzek.de) beantwortete die Frage nach zweimaliger Nachfrage mit dem Hinweis, dass Herr Fitzek nicht rauche. Na also. Note: 5 (ax) <<
>> Ein Tiefpunkt im Literarischen Quartett. Es ist das am schlechtesten jemals bewertete Buch. Es hat mit Schule und Elternabend so viel zu tun, wie dieses Buch mit Literarur. Voll von unerträglichen Klischees, platten Einfällen und einer von grotesken Vergleichen zerschundenen Sprache. Nicht witzig, sondern aberwitzig dümmlich. Stichworte: Aromayoga und Polysusi69. Note . 6 –( ün)<<
 dtv 188 Seiten
dtv 188 Seiten
<< Wenn einer am Ende das Wunder verdient, dann jener Mendel Singer, den Joseph Roth, seinem biblischen Vorbild folgend, durch qualvolle Schicksalsschläge schickt. „Fromm, gottesfürchtig und gewöhnlich“ so wird der 30jährige Thoralehrer (was Analphabetismus nicht ausschließt) eingeführt. Die „Fruchtbarkeit seiner Lenden“ steht im Kontrast zu „seiner Hände Armut“ (anders als der biblische Hiob) und nachdem sich ersteres mit der Geburt des 4. behinderten Menuchim ebenfalls legt, folgen freud- und lustlose Jahrzehnte. Schonungslos offen sind die Bilder vom Zerfall einer Ehebeziehung. Gefangen im Korsett jüdischer Orthodoxie verweigert Mendel für Menuchim mögliche medizinische Hilfe. Bedingungslose Opferbereitschaft und Selbstaufgabe, das ist die kleine Welt Mendels. „Welche Hilfe erwartest du von den Menschen, wo Gott uns bestraft“ fragt Mendel Deborah, die sich wenigstens neben Ahnenkult und Fasten noch mit den Heilungs-Prophezeiungen eines jüdischen Rabbi zu trösten vermag. Brutalität der Geschwister gegenüber „dem missratenen Krüppel“, eine lustbetonte Tochter, die sich mit „Kosaken“ einlässt, ein für den galizischen Juden fremdes Zarenreich, das seine beiden Söhne zum Militärdienst zwingt, diese „Plagen“ scheinen mit der Amerikageschichte Schemarjahs eine Wende zu nehmen. Etwas klischeehaft der Aufstieg des Zarendienstdeserteurs zu Sam, dem Kaufhausbesitzer. Entgegen dem Rat des Rabbi wird Menuchim zurückgelassen. Das „gesegnete Land“ erweist sich janusgesichtig. Für Mendel überwiegt das Verharren in seiner alten Welt schlichter Frömmigkeit, für die junge Generation gilt ein zukunftszugewandtes Amerikabild. Brillant wie Roth in wenigen Zeilen diese vermeintlichen Verheißungen skizziert. Und gerade als im 58. Jahr zum ersten Mal „die Sorgen das Haus Mendels Singers“ verlassen (Kap.XI), folgen die unerbittlichen Schicksalsschläge. Sam fällt fürs amerikanische Vaterland in Europa, Deborah stirbt an Trauer über den verlorenen Sohn und die liebestolle Tochter Mirjam, von der der Vater schon seit der Kosakenepisode glaubt, der „Teufel sei in sie gefahren“ wird verrückt. Der verlorene Bruder, lieb ich Mac oder Herrn Glück, für sie und für mich als Leser etwas zu viel. Was folgt ist die Wende: Mendels Zorn auf Gott. Nicht mehr der „wacklige Körper“, der am ganzen Körper betet, sondern der aufbegehrende Mendel, der sein „rotsamtenes Säckchen“ (Gebetsriemen, Gebetsmantel, Gebetsbücher und mit ihm Gott „verbrennen will“. Dass nun gerade die jüdischen Freunde, deren Sinn eher nach Geld statt nach Sabbat stand und auf deren „alten Glauben“ der „Staub der Welt schon dicht lag“ Mendel vor dem endgültigen Abfall von Gott retten und ihn an die Hiobgeschichte erinnern, verweist auf ein reichlich pragmatisches Glaubensverständnis von Joseph Roth. Reichlich knitze auch, dass sich der lästernde und gottfluchende Mendel als zehnter Mann zum jüdischen Abendgebet für reine Anwesenheit bezahlen lässt. Nach so viel Abkehr vom Glauben naht beim jüdischen Osterfest im Hause Skowronnek mit der Lichtgestalt des jüdischen Komponisten Menuchim Kossak das mit dem Romantitel „Hiob“ schon erwartete Wunder: Die Heimkehr des verlorenen Sohnes und die Buße des sündigen Vaters. Das Schlussbild des Romans eine Fotografie der zukünftigen Singer-Kossak Familie im Zimmer eines Nobelhotels : filmreif amerikanisch verkitscht. Wohl dem, der wie Mendel angesichts seiner Lebensgeschichte noch an die „Größe der Wunder“ glaubt.
So fremd mir die bedrückende Welt dieses „gewöhnlichen Juden“ auch ist, Joseph Roth beschreibt sie sehr anschaulich. Erzählperspektiven und Erzählstile sind variantenreich. Meist nüchtern registrierend, wenn aus der Perspektive der Figuren gesprochen wird, etwa die Beschreibung der Mendel-Deborah Entfremdung, die Kutschfahrten mit Sameschkin oder – ein highlight – Mendels Dokumentenepisode in Nummer 84. Daneben poetisch liebevoll Stimmungen und selbst bei allem Unglück für Mendel einzelne Mirjam Episoden.
Josef Roths Roman entstand 1930. Auch sein „Hiob“ lässt die Theodizee-Frage unbeantwortet. Note: 1/2 (ai )<<
>> Wie im Alten Testament geschrieben steht, war Hiob ein Mann Gottes. So gottesfürchtig, dass Gott sich beim Disput mit dem Satan weit aus dem Fenster lehnte: dem Teufel würde es nicht gelingen, Hiob vom rechten Weg abzubringen. Darauf nahm der Teufel dem wohlhabenden Hiob sukzessive alles. Doch nach jeder weiteren Katastrophe lobpreiste Hiob seinen Gott: „Der Herr hat es gegeben. Der Herr hat es genommen. Gelobet sei der Herr.“ Der Herrgott wusste es zu schätzen und belohnte den Gottesdiener überreichlich, da sich dieser jeder Versuchung widersetzte.
Roth hat die alttestamentarische Episode in das Ostjudentum des frühen zwanzigsten Jahrhundert transformiert. Sein Jude heißt Mendel Singer, lebt unter ärmlichsten Bedingungen im russisch-polnischen Grenzgebiet und gibt sich ähnlich gottesfürchtig. Doch als die nicht enden wollenden Schicksalsschläge überhand nehmen, verdammt der alte Singer schließlich seinen Gott. Diese Verfremdung spiegelt vermutlich die tiefe Enttäuschung des Autors wider, der als Jude im aufziehenden Nazideutschland die alte Theodizeefrage aufgreift: wie ein allmächtiger Gott größtes Leid geschehen lassen kann. Roths Protagonist emanzipiert sich von der orthodoxen Frömmigkeit. Als am Ende des Romans ein verloren geglaubter Sohn Mendels wie ein auferstandener Messias den Vater aus dem Elend errettet, driftet die Darstellung in märchenhafte Klischees ab. Der Text lässt die Vermutung zu, dass Mendel nicht bekehrt wird – oder doch? Was will uns das sagen?
Mendel ist mittelloser Gebetslehrer für eine Handvoll Vorschulkinder. Mehr nicht. Verachtet von seiner Frau Deborah ob seiner Erfolglosigkeit, führt Mendel dennoch ein in sich ruhiges Dasein, weiß er sich doch im Einklang mit den göttlichen Geboten. Drei Kinder toben durch die winzige Hütte bis schließlich noch ein viertes dazukommt. Als ob Deborahs Leib nicht mehr ausreichend Lebenssaft hatte spenden können, wird der kleine Menuchim als von epileptischen Anfällen geschüttelter Krüppel geboren. Die Geschwister hassen ihn, versuchen den sprachunfähigen Bruder zu ertränken. Doch etwas Unbestimmtes verleiht Menuchim eine unsterbliche Zähigkeit. Die Eltern empfinden eine besonders tiefe Verbundenheit mit ihrem behinderten Kind, die die Liebe zu den drei anderen Kindern fast vergessen macht.
Als die älteren Brüder das wehrfähige Alter erreichen, drohen beide für 25 Jahre zwangsrekrutiert zu werden. Einem kann die Mutter einen Schleuser ins Ausland finanzieren, für den zweiten reicht das Ersparte nicht. Doch dieser hat zum Entsetzen der Eltern inzwischen Gefallen am Militärdienst gefunden und wird Kämpfer der zaristischen und später weißen Armee. Ein grausamer Tod scheint ihm sicher. Währenddessen pubertiert sich Tochter Mirjam durch die benachbarten Kornfelder, wo ihr als hormonwütiger Heißsporn auch gern mal drei Kosaken gleichzeitig gerade genug sind. Der Vater ist entsetzt, während die Mutter schon lange aufgegeben hat. Als dann Post vom inzwischen in die USA geflüchteten Sohn Schemarjah kommt, beschließen sie nach Amerika auszuwandern, um die Tochter dem Sündenpfuhl zu entreißen.
Was folgt, ist ein kafkaesker Spießrutenlauf durch den korrupten Bürokratensumpf, wo auch den Nackten noch in die Tasche gegriffen wird. Es scheint lange Zeit unmöglich, die Ausreisepapiere zu erhalten. Kaum vorstellbar gelingt der Familie schließlich doch die Überfahrt nach Amerika. Mit Nachbarn einigt man sich, dass Mendels Hütte ihr neues Eigentum wird, wenn sie sich um den schwer behinderten Menachim kümmern, den sie zurücklassen müssen.
Sohn Schemarjah ist inzwischen in den USA bestens assimiliert, trägt jetzt den Namen Sam und avanciert zum erfolgreichen Geschäftsmann. Die Familie findet im jüdischen Viertel Unterkunft, die Tochter einen Mann, der Sohn eine Frau, die ihm schon bald eine Familie beschert. Amerika, das neue gelobte Land. Doch dann bricht der erste Weltkrieg aus. Überraschend treten die USA in die Kämpfe ein, so dass auch Sam aus Überzeugung für seine neue Heimat freiwillig in den Krieg zieht. Er überlebt nur wenige Wochen. Mit der Todesnachricht bricht sowohl die Mutter zusammen und verstirbt, wie auch Mirjam, die eine degenerative Psychose entwickelt, die nur in einer geschlossenen Anstalt behandelt werden kann. In kürzester Zeit hat sich Mendels paradiesische Geborgenheit in eine grausame Hölle verkehrt: der älteste Sohn vermutlich in Russland umgekommen, der zweite im Weltkrieg gefallen, der jüngste verkrüppelt und lebensunfähig in der fernen Heimat, die Tochter unheilbar vom Teufel besessen und die Gattin ob dieser Qualen tot umgefallen. In der Interpretation des Geschehens wird auch die ewig umstrittene Frage berührt, ob die Assimilation orthodoxer Jude an veränderte Lebensumstände nicht nur Verrat am Ursprünglichen ist sondern auch den Untergang vorwegnimmt.
Für Roth markiert der Roman einen Wendepunkt: Aufgabe seiner engagiert kritischen journalistischen Arbeit hin zur traditionellen Literaturform auf Grundlage jüdischer Ursprünge. Roth selbst spricht von einer „anderen Melodie“, die ihn bewegt. Eingebettet ist dieser Wandel in eigene Schicksalsschläge, die der gläubige Autor als göttlichen Fluch empfindet. Die Parallelen zum Roman sind offensichtlich. Während Mendel Singer sich schuldig macht, als er den verkrüppelten Sohn in der verruchten Heimat zurücklässt, glaubt Roth seine geliebte Frau Friedl verraten zu haben, als sie unheilbar an Schizophrenie erkrankt.
Ein kontrovers interpretierter Unterschied zwischen dem Alten Testament und Roths Hiob liegt in der Inszenierung der Protagonisten. Hiob ist Milliardär seiner Zeit, Mendel von Anfang an verarmt und hat damit eine nur geringe Fallhöhe. Hiob hält am Glauben fest und wird dafür göttlich entschädigt. Mendel verliert seinen Glauben und kehrt vermutlich nicht (?) zu ihm zurück. Dennoch wird auch Mendel erlöst und belohnt: sein ehemals schwerst behinderter Sohn ist zwischenzeitlich wundersam geheilt, mittlerweile berühmter Dirigent und findet in Umkehrung den verlorenen Vater. Die metaphorische Belohnung ergibt sich mit dem gemeinsamen Umzug ins legendäre Hotel Astor. Vermutlich ist diese Wendung parodistisch zu verstehen, war Amerika doch für Roth die Entwicklung von der Barbarei zur Dekadenz ohne den Umweg über die Kultur. Dazu könnte auch der als Mendels Tod interpretierte letzte Buchabsatz passen: „ Während sie sich langsam schlossen, nahmen seine Augen die ganze Heiterkeit des Himmels in den Schlaf hinüber…“
Ein Roman der alten Schule, interessant für Interessenten jüdischer Geschichte, sprachlich auch mit Höhepunkten z.B. in der Beschreibung Amerikas. Note: 2/3 (ur)<<
>> Mendel Singer, Du Allerärmster. Leben mit einem Gott, der nur danach trachtet zu kontrollieren, zu strafen, zu richten. „Gott ist grausam, und je mehr man ihm gehorcht, desto strenger geht er mit uns um.“ Um Gottes willen.
Das ist keine Hilfe für den Alltag, für das Leben. Unglück oder Pech kann nur als göttliche Strafe gedeutet werden. Ohne Gott zu leben, was wäre das für eine Befreiung. Mir wurde ein anderes Gottesbild vermittelt. Manchmal fällt er mir erst ein, wenn Not am Mann ist. Dann werde ich zum Bittsteller. Ihn anzusprechen kann beruhigen. Er hilft, aber nicht immer… Aber ich weiß, Unglück oder Pech, das mir begegnet, ist nicht von ihm geschickt. Eher von Mitmenschen verursacht oder auch von mir selbst. Richtig gefallen hat mir nur ein einziger Satz:“Denn die Genüsse sind stärker, solange sie geheim bleiben.“ (Seite 16). Note: 3+(ax) <<