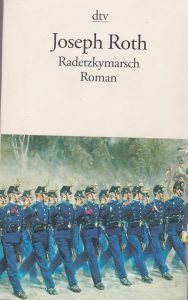 dtv 1981, 404 Seitern
dtv 1981, 404 Seitern
>>Joseph Roths Radetzkymarsch ist mehr als ein Roman über den Niedergang einer Familie oder einer Monarchie – er ist eine Elegie auf eine untergehende Weltordnung. In den Figuren des Hauses von Trotta spiegelt sich über vier Generationen hinweg die gesamte Habsburgermonarchie, deren Glanz schon matt geworden ist, während sie sich selbst noch in die Pose imperialer Größe stellt. Roth erzählt nicht von heroischen Taten, sondern von Zeremonien, Ritualen und hohlen Loyalitätsbekundungen, die wie eine schöne Fassade vor einem Gebäude stehen, das längst Risse trägt.
Gerade in dieser Entlarvung liegt die bleibende Kraft des Romans. Roth beschreibt, wie Gesellschaften sich in Illusionen einrichten: im Glauben an ewige Stabilität, im Vertrauen auf Institutionen, die längst erstarrt sind. Es ist ein kollektives Verdrängen des Zerfalls – ein Phänomen, das sich auch heute beobachten lässt. Auch in unserer Gegenwart klammern sich Gesellschaften an politische Gewissheiten oder nationale Mythen, während im Hintergrund die Weltordnung ins Wanken gerät.
Besonders aktuell wirkt Roths literarische Diagnose im Hinblick auf die „Vorboten eines Krieges“. Radetzkymarsch schildert das langsame Taumeln in die Katastrophe, gespeist aus Selbsttäuschung, Blindheit und der Unfähigkeit, sich neuen Realitäten zu stellen. Man könnte sagen: Roths Figuren sind nicht Opfer von Zufällen, sondern von einer Mentalität, die schlafwandlerisch in den Krieg mündet.
Roths großartige Sprache bespielt einerseits den Glanz der Vergangenheit und zeigt gleichzeitig schonungslos ihre Leere. Diese Ambivalenz – Elegie und Analyse zugleich – macht Radetzkymarsch zu einem großen politischen und literarischen Werk. Es ist nicht nur Erinnerung an ein versunkenes Reich, sondern ein Spiegel, der uns vor Augen hält, wie fragil jede Ordnung ist, wenn sie sich im Pathos einrichtet und das Wirkliche nicht mehr wahrnimmt. Note : 1 – (ün)<<
<<Wir werden Zeuge einer Familiengeschichte der Trottas, in der sich zugleich der Zerfall des habsburgischen Vielvölkerstaates widerspiegelt. Anschaulicher als in jedem Geschichtsbuch vermittelt Joseph Roth ein Sittengemälde einer dynastischen Gesellschaft, deren Strukturen im Wesentlichen bis ins kleinste Detail durch ständische Regularien und Konventionen bestimmt werden. Vater-Sohn Beziehungen gleichen dem Kaiser-Untertanen Prinzip, familiäre Begegnungen gleichen den Ritualen kaiserlicher Audienzbesuche bis in die Art der Kommunikation. Vier Mannesfinger von oben zwei Mannesfinger Abstand vom seitlichen Rand, die äußere Form der Vater-Sohn Briefe auf Oktavbogen, sie spiegeln sich auch im distanziert förmlichen Inhalt. Das Porträt des Helden von Solferino an der Wand des Herrenzimmers von Josef von Trotta und das allgegenwärtige Kaiserporträt zu Pferde, sie stehen im Kleinen wie im Großen für ehrfurchtsvolle Vorbildfunktion. Diese verblasst gänzlich in der Enkelgeneration und mit der fortschreitenden Senilität des Kaisers. Nahm man das Bildnis vom Haken, wie im Epilog beschrieben, hatte die Stunde des letzten Trottas und zugleich des Kaisers geschlagen. Die Symptome der Verfalls prägen die Romanhandlung von Beginn an: Von der gefälschten Legendenbildung der Schlacht von Solferino (Der Held und „Ritter der Wahrheit“ quittiert aus Verbitterung die Armee) über die Auflösung soldatischer Tugenden (mehr „Liebesmanöver“ Casino und Schulden als militärische Disziplin) bis hin zu zunehmend nationalistischen Freiheitsbewegungen (zunächst die Tschechen) und erstem „staatsgefährdenden Umtrieben“ (sozialdemokratische Arbeiterproteste) zieht sich das Band der Auflösung. Es sind nicht nur die großartigen Charakterisierungen des Romanpersonals (selbst Diener-Nebenfiguren erzählen eine eigene Geschichte), die lebendigen Schauplatzbeschreibungen (atmosphärisch am dichtesten die Station des Jägerbataillons von Leutnant Trotta an der russ. Grenze), die von einem Stück menschlicher Tragik geprägten Episoden wie die Slama- und Frau v. Taußig Geschichte oder die brillante Beschreibung der Überlegungen anlässlich des hundertsten Geburtstags des Dragonerregiments, wer denn wie und wann einzuladen sei, die zeigen wie ein historischer Roman zum Lesegenuss wird, sondern es ist vor allem die Sprache des Erzählers, die den Leser zum (an)teilnehmenden Beobachter macht.
Note : 1 (ai)
P.S. „Lassen S‘ die Geschicht“ – der kaiserliche Rat an den Helden von Solferino hier nicht zu verzeihen!
>> Johann Strauss komponierte den Radetzkymarsch als Lobeshymne, nachdem das gefährdete Österreich die Lombardei erobert und den Kaiser zurückbrachte hatte. Jahre später wurde die Lombardei in der Schlacht von Solferino wieder verloren, doch der Kaiser blieb noch ein Weilchen, während der Radetzkymarsch nachklang. 1916 war der Herrscher tot. Das österreichisch-ungarische Kaiserreich zerfiel in zahlreiche Nationalstaaten. Der für seine späte, rückwärtsgewandte Utopie bekannte Autor Josef Roth griff diese Phase des Identitätsverlustes auf. Er selbst war Teil des Reiches gewesen, verfasste das Werk aber erst in der zweiten historischen Verlustphase während des Anschlusses Österreichs an Nazideutschland. Gemessen an den nationalsozialistischen Grausamkeiten erschienen Roth die Absurditäten des untergegangenen Kaiserreiches als liebenswerte Ordnung.
Dennoch atmet das vorliegende Werk diese Sehnsucht nur am Rande. Stattdessen ist es eher vom Odem der Buddenbrooks durchweht. Ein Geschlecht im Niedergang in einer sich neigenden Epoche. Interessanterweise platziert Roth den katapultartigen Aufstieg seiner Protagonisten in den historischen Moment, als die Zersetzung des Reiches Formen annimmt – also in die Schlacht von Solferino. In dieser Schlacht rettet der Infanterist Trotta dem Kaiser das Leben. Das prompte Adelsprädikat für den Helden samt fortwährender Protegierung wird daraufhin über drei Generationen weitervererbt. Auf den Helden folgt der Sohn als dem Militär abgewandter Amtmann und schließlich der dem Militär entfremdete Enkel Karl-Joseph von Trotta. Ihm ist der größte Teil des Werks gewidmet. Den individuellen und den nationalen Faden lässt Roth synchron abreißen, als die Trottas und der Kaiser fast zeitgleich das Zeitliche segnen. Das Buch hat mit der Zusammenführung begonnen und endet auch mit ihr. Protagonisten und politische Ordnung sind jetzt aus der Zeit gefallen.
Am Anfang steht der Bauernsohn und Großvater des Hauptprotagonisten. Er wirft sich als Infanterist in den Kugelhagel, der im Gefecht dem Kaiser gilt. Beide überleben. Der Herrscher belohnt den Untertan. Fortan ist der redliche Held selbst in Schulbüchern verherrlicht. Doch dieser macht sich zum Prinzen auf der Erbse, als er einen kleinen Fehler entdeckt. Der fußläufige Infanterist, der er war, wurde als reitender Kavallerist dargestellt. Für den prinzipientreuen Soldaten eine untragbare Fälschung, die ihn den Heeresdienst quittieren lässt. Vertrieben aus dem Paradies der einfachen Gläubigkeit. In der Folge untersagt er auch seinem Sohn die Militärkarriere. Doch der von nun an adelige Name von Trotta garantiert Auskommen und gehobene Beamtenstellung. Der Sohn wird also angesehener Bezirkshauptmann mit ebenso herrschaftstreuer Gesinnung. Dessen Sohn Karl-Joseph wiederum, der Enkel des Helden, wird wider Willen ins Heer genötigt. Am Ende setzt er zu seiner eigenen Heldentat an, als er beim Wasser holen für verdurstende Kameraden erschossen wird. Im geltenden Wertekodex jedoch ein peinlicher Tod. Gestorben nicht mit der Waffe in der Hand, sondern zwei Wassereimern. Kein Stoff für K&K-Geschichtsbücher.
Der Bezirkshauptmann. In der Vater-Sohn Beziehung verdichtet Roth auf der individuellen Ebene die gesellschaftliche Problematik von Amtsschimmel, Etikettenlähmung, politischen Widersprüchen, Machtmissbrauch und Rollenverpflichtung – auch zwischen den Geschlechtern. Die Zeitläufe folgen einer unumstößlichen Taktung. Im einheitlichen Morgenmoment wird der ausladende Bart frisiert. Die Reihenfolge der Menüteile beim allein absolvierten Mahl erfolgt minutengenau. Der Radetzkymarsch wird jeden Sonntag unter seinem Paradefenster intoniert. Der Zeremonienmeister zelebriert anschließend stets die gleiche Zigarrensorte mit dem Bezirkshauptmann. Die Liste der ewigen Kreisbewegungen ist lang und füllt die Tage. Zwischenzeitlich gilt es den über alles geachteten Kaiser Franz Josef I zu repräsentieren.
Die Beziehung zum einzigen Sohn Karl-Joseph ist entsprechend formal. Ein Sohn ist Bestandteil einer Gesellschaftsmaschinerie. Ein Zahnrad, dessen Zacken sauberst herauszuschleifen sind. Freude und Freunde bleiben unbekannte Größen. Eine empathische Mutter fehlt. Vater-Sohn Gespräche sind Prüfungen. Väterliche Ansagen sind auch im Erwachsenenalter mit „Jawohl, Papa!“ zu quittieren. Schon bald muss sich der Bub in die Kadettenschule und von dort ins Kasernenabseits begeben. Aus der Ferne ist monatlich ein Brief zu schreiben. Über Jahre hinweg wird nie etwas Inhaltliches darin stehen. Die Seitenabstände zum Papierrand werden jedoch bis zum Schluss präzise eingehalten. Der Vater antwortet jedes Mal mit einer Zeile – ebenfalls frei von Inhalten. Das formale Ritual als sich vergewissernder Selbstzweck.
Dann rücken auch für den Alten die Detonationen näher. Der langjährige Hausdiener verstirbt im Dienst. Der Kaiser stirbt. Der Sohn verwahrlost in Suff und Schulden und stirbt würdelos im Krieg. Mit dem regimetreuen Tod seines Sohnes kollabiert schließlich sein Seelenleben. Er schreit den Verlust in die Welt und spürt zu spät, dass er liebte in einer lieblosen Zeit. Im Danach ergibt das Weiterleben keinen Sinn mehr.
Karl-Joseph. Der Sohn hat diesen einen Bezirkshauptmann-Vater. Die Mutter bleibt in der streng reglementierten Kaiserepoche nebulös. Erzogen und noch im Erwachsenenalter wird der Sohn vom leiblichen Vater wie ein Rekrut deklassiert. Pflichterfüllung scheint der einzige Berührungspunkt. Karl-Joseph gehorcht, leidet sich durch die prestigeträchtige Kavallerie, macht sich zu Pferde lächerlich, lässt sich in die geschmähte Infanterie am äußersten Rand des Reiches versetzen. Die Tristesse wird im neunziggrädigen Fusel ersoffen. Mit weichem Herz werden verschuldete Kameraden alimentiert und Huren verwöhnt, bis ein ruinöser Schuldenberg nur noch von Vater samt Kaiserintervention abgetragen werden kann. Der junge Leutnant ist gutmütig, jedoch zunehmend willenlos. Als er schließlich doch den Militärdienst aufkündigt, findet er in einer einfachen Lebensweise vorübergehend Ruhe. Doch dann bricht der I. Weltkrieg aus. Der Kaiser ruft und die verinnerlichte Vaterstimme treibt ihn in den lächerlichen Tod.
Das Werk. Ein Roman im Takt des Radetzkymarsches. Ein eingängiger Rhythmus, in dem sich der Stillstand des dahindösenden Friedens und das Sterben im verordneten Krieg ertragen lassen. Wenn der Krieg die Freiheit des Soldaten ist, dann verdichtet der Radetzkymarsch alle disziplinarischen Gefühle zu einer Siegesparole. Der Marsch wird zur Melodie des Ablebens. Für die von Trottas, für den Kaiser, für das Gesellschaftsgefüge.
Für den Leser ist das Internalisieren dieser Lektüre nicht ohne Mühe: der zeitlich entrückte Inhalt, der mit bedeutenden Details angefüllt ist und verstanden werden will. Die Länge der Betrachtungen. Die Sprache. Und doch wird der Leser auch belohnt mit eloquenten Passagen, und vor allem mit psychologischer Schärfe. Wenn etwa der den Dienst verweigernde Sohn dem Vater die Briefe vorenthält, schreibt Roth: „ Der Sohn schwieg. Aber der Vater hörte ihn schweigen.“ Für seine Zeit vermutlich ein außergewöhnlicher Wurf. Heute jedoch schon ein wenig von gestern. Note: 3 (ur)<<
>> Ein beliebter Text zum Radetzky-Marsch lautet:“Alles klar, alles klar, alles bleibt wie‘s war.“ Für die Schlacht von Solferino vom 24.6.1859 gilt dies nicht. Mit circa 30 000 Toten war sie die blutigste Auseinandersetzung seit der Schlacht von Waterloo.
Henry Dunant schrieb über die Schlacht das Buch „Erinnerung an Solferino“. Dies führte zur Gründung des Roten Kreuzes und zur Vereinbarung der Genfer Konvention von 1863.
Berühmter als das Buch von Dunant ist der Roman Radetzky-Marsch von Joseph Roth, der mit der Schlacht von Solferino beginnt. Bei Wikipedia und Kindler ist der Roman vorbildlich rezensiert. Deshalb beschränke ich mich hier auf einige subjektive Anmerkungen, die einen roten Faden vermissen lassen.
Verhältnis Vater-Sohn: Irritierend die subalternen Floskeln, nicht nur in der schriftlichen Kommunikation. „Jawohl, Vater jawohl.“ Später die hilflose„Kommunikation“ zwischen Vater und betrunkenem Sohn. Eine bewegende Begegnung. Wer ist hier mehr zu bedauern, Vater oder Sohn? Nicht nachvollziehbar ist für mich die Erregung des Vaters über eine übertriebene Darstellung seiner Heldentat in einem Schulbuch, die ihn an den kaiserlichen Hof treibt. Dazu der ironisch-zynische Kommentar eines Notars: “Alle historischen Daten werden für den Schulgebrauch anders dargestellt“. Ein Satz, der jeden Schulbuchautor auf die Palme bringen sollte.
Sterben und Tod: In der Schilderung von Sterbeprozessen zeigt Roth große Meisterschaft. Geht es ihm wie seiner Romanfigur Carl Joseph über den er schreibt:“Er genoß die Nähe des Todes…“?
Dies gilt auch überwiegend für erotische Schilderungen. Die Verführung des jungen Carl Joseph wird in dem genialen Satz „eine große Welle aus Wonne, Feuer, Wasser“ resümiert.
Roth hat ein Faible für Frösche. Ich habe nicht gezählt, wie oft Frösche in den unendlichen Sümpfen quaken. Auch nicht wie oft zum 90 Prozentigen gegriffen wird, fast schon ein roter Faden des Geschehens.
Ein geringer handwerklicher Fehler unterläuft dem Autor, wenn er in einem slowenischen Dorf eine Moschee ansiedelt.
Nicht erstaunlich, dass der Roman mehrmals verfilmt wurde. Der Satz „Und es war Sommer“ (Seite 24) könnte Peter Maffay zu seinem erfolgreichsten Lied inspiriert haben.
Man verzeihe mir die Egozentrik, wenn ich den Satz „Der liebe, gute Max!“ für den schönsten des Romans halte. Note: 2 (ax) <<

 Mattes&Seitz, 2024 | 235 Seiten.
Mattes&Seitz, 2024 | 235 Seiten. >>Deutscher Buchpreis 2024, die Latte liegt hoch. Da kann die Kritik auch schon mal heftig ausfallen. Dieses Buch reißt die Latte nicht, es läuft unten durch. Ich werde den Verdacht nicht los, dass andere, literaturfremde Gründe eine Rolle bei der Vergabe gespielt haben: Die Autorin, eine Frau aus der freien, linken Theaterszene Leipzigs, die den woken, mutmaßlichen Zeitgeist bedient. Es geht viel um Tatoos, da wird im Text gegendert, da ist – ernst gemeint von einer „Performerin, weiblich gelesen“ die Rede. Das ist selbst in der immanenten Genderlogik, mit Verlaub, offensichtlicher Blödsinn. Die Love-Scammer aus Nigeria, die unzählige Frauen ins finanzielle und emotionale Unglück stürzen, ernten viel Verständnis, rächen sie sich doch an den Nachfahren der ehemaligen Kolonialmächte. Kritische Recherchen dazu werden beiläufig abgetan. („Was soll man von SPIEGEL TV auch erwarten“). Das Ballett ist natürlich „kolonialer als die stärkste Kolonialmacht, weil es immer an weiße Körperideale“ geknüpft ist. Bei geschilderten Fahrscheinkontrollen in Leipzig beobachtet sie, wenig überraschend, latenten Rassismus. Das ganze Buch dann selbstredend von einem „Sensitivity Reader“ geglättet, der die Autorin auf „verborgene Machtgefälle und Diskriminierungen aufmerksam machte“, wie die Autorin in einem umfangreichen Nachwort bekennt.
>>Deutscher Buchpreis 2024, die Latte liegt hoch. Da kann die Kritik auch schon mal heftig ausfallen. Dieses Buch reißt die Latte nicht, es läuft unten durch. Ich werde den Verdacht nicht los, dass andere, literaturfremde Gründe eine Rolle bei der Vergabe gespielt haben: Die Autorin, eine Frau aus der freien, linken Theaterszene Leipzigs, die den woken, mutmaßlichen Zeitgeist bedient. Es geht viel um Tatoos, da wird im Text gegendert, da ist – ernst gemeint von einer „Performerin, weiblich gelesen“ die Rede. Das ist selbst in der immanenten Genderlogik, mit Verlaub, offensichtlicher Blödsinn. Die Love-Scammer aus Nigeria, die unzählige Frauen ins finanzielle und emotionale Unglück stürzen, ernten viel Verständnis, rächen sie sich doch an den Nachfahren der ehemaligen Kolonialmächte. Kritische Recherchen dazu werden beiläufig abgetan. („Was soll man von SPIEGEL TV auch erwarten“). Das Ballett ist natürlich „kolonialer als die stärkste Kolonialmacht, weil es immer an weiße Körperideale“ geknüpft ist. Bei geschilderten Fahrscheinkontrollen in Leipzig beobachtet sie, wenig überraschend, latenten Rassismus. Das ganze Buch dann selbstredend von einem „Sensitivity Reader“ geglättet, der die Autorin auf „verborgene Machtgefälle und Diskriminierungen aufmerksam machte“, wie die Autorin in einem umfangreichen Nachwort bekennt.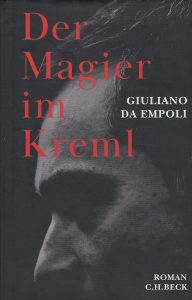 C.H. Beck | 265 Seiten
C.H. Beck | 265 Seiten Siedler 2014 | 224 Seiten
Siedler 2014 | 224 Seiten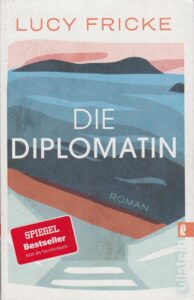 Ullstein, 2022 | 254 Seiten
Ullstein, 2022 | 254 Seiten mikrotext 2022 | 213 Seiten.
mikrotext 2022 | 213 Seiten. Droemer 334 Seiten.
Droemer 334 Seiten. dtv 188 Seiten
dtv 188 Seiten Blessing | 317 Seiten
Blessing | 317 Seiten