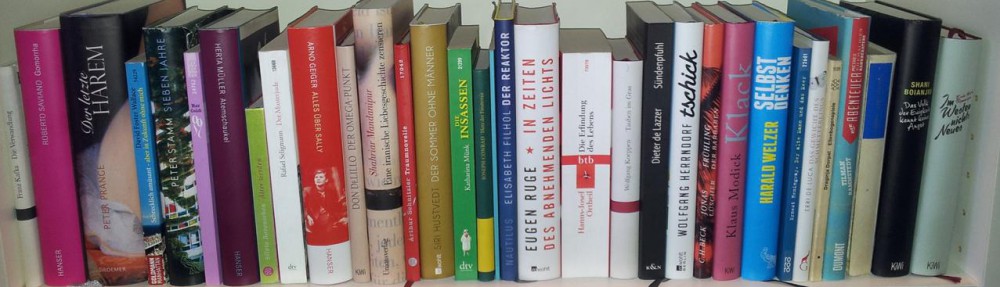Bibliothek SG 1986 / 1786 – 29 Seiten
>>In der Erzählung verdichtet Schiller einen historischen Kriminalfall zu einer Sozial-, Justiz- und Gesellschaftskritik. Auf den authentischen Fall eines Mörders aufbauend, erhebt er die Prinzipienforderung, dass die Bewertung von Taten stets auch die Ursachen des Verhaltens beleuchten muss.
Der Protagonist C. Wolf ist der hässliche Spross einer alleinstehenden Mutter, in deren schlecht laufender Gastwirtschaft er früh mitarbeiten muss. Von den Kameraden gehänselt, sucht er stattdessen die Nähe des eigennützigen Mädchens Hanna, die ihn prompt ausbeutet. Nur durch Geschenke lässt sie sich beeindrucken. In seiner Not wird der mittellose Junge, der später den Spitznamen Sonnenwirt erhalten wird, zum Wilddieb, um seinem Schwarm Wünsche erfüllen zu können. Als der Förstersohn und Nebenbuhler C. Wolf auf die Schliche kommt und ihn anzeigt, wird dieser zum ersten Mal verurteilt. Durch die endlose Schmach öffentlich verurteilt worden zu sein, beginnt eine verhängnisvolle Abwärtsspirale. Der Sonnenwirt räubert ein zweites, ein drittes Mal. Das Strafmaß steigt von Mal zu Mal und sämtliche Versuche, dass er einer geregelten Arbeit nachgehen möge, scheitern. Während einer langjährigen Festungshaft verroht er in der Gesellschaft von Mördern vollends. Wieder auf freiem Fuß, begegnet er seinem ehemaligen Denunzianten und streckt ihn nieder. Trotz der eskalierten Tat – oder gerade deshalb – bricht sich eine moralische Urgewalt in C. Wolfs Wesen Bahn. Er beraubt den Getöteten nicht, weil er Rache, nicht aber Reichtum will. Auf der Flucht begegnet er einem Banditenhaufen, der ihn aus Respekt vor seinen legendären Taten zum Anführer ernennt. C. Wolf scheint endlich gebettet zu sein in eine soziale Gemeinschaft. Doch veranlassen ihn schließlich Neid, Missgunst und die Furcht verraten zu werden, zu flüchten.
Als seine ungewöhnliche Erscheinung schließlich in der Öffentlichkeit auffällt, folgt eine zunächst unbegründete, literarisch fesselnde Darstellung der Inhaftierung. Seine wahre Identität bleibt zunächst unerkannt. Im Laufe dieser Zeit vollzieht sich ein dramatischer Wandel. Von der respektvollen Ansprache des Amtsrichters berührt, die ihm überraschend das Gefühl vermittelt, als Mensch wahrgenommen zu werden, gibt er sich als Sonnenwirt zu erkennen. Eine große Dankbarkeit für eine kleine Geste.
Dramaturgisch geschickt, bricht die Erzählung, die im Stil einer subjektiven, teils wertenden Dokumentation formuliert ist, an dieser Stelle ab. Aus dem Vorspann erfahren wir, dass dem Sonnenwirt das Geständnis letztlich das Leben kostete. Eine großartige Erzählung, die – abgesehen vom 200 Jahre alten Sprachduktus – ein Plädoyer unserer Gegenwart sein könnte. Sowohl die Aktualität, wie auch die entlarvende Kausalität gesellschaftlicher Zusammenhänge, sozialer Mitverantwortung und angedeutete Lösungsalternativen sind brandaktuell. Für das ausklingende 18. Jahrhundert vermutlich ein revolutionärer und für die damalige Zeit überfordernder Blickwinkel. Für heute jedoch ein Schiller, der viel eingängiger für Schüler und Erwachsene sein dürfte als andere stilfremde, kunstverlorene Dramen, deren inhaltliche Übertragung auf die Gegenwart allzu bemüht erscheinen. Note: 1 (ur)<<