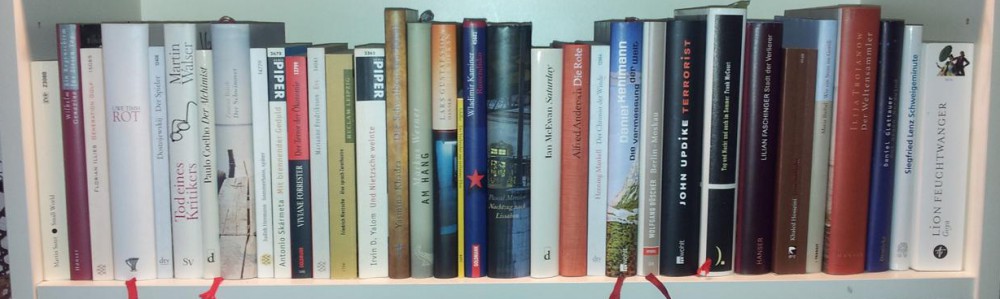Alexander Fest Verlag (1997) – 117 Seiten
>>Das Werk behandelt die Traurigkeit in einer glücklosen Beziehung zwischen Alberta und ihrem Jugendfreund Nadan. Es ist eine toxische On-Off Liaison. Literarisch schon oft abgehandelt. Der Kunstgewinn im Teil I ohne Überraschungen. Im Teil II jedoch die Wende, als die Erzählung der Hauptprotagonistin endet, und die Autorin persönlich auftritt. Sie problematisiert das Verfassen dieses Romans im Kontext ihrer gerade gelebten Ehe. Ein Ineinandergleiten der fiktiven und vermeintlich realen Ebene zeichnet sich ab. Und damit versprechen die Beziehungsinhalte literarisch zu fusionieren. Ist das gelungen?
Alberta und Nadan fühlen sich periodisch angezogen ohne jedoch wirklich zueinander zu finden. Wie eine Sucht mit überwunden geglaubten Rückfällen kommen sie nicht voneinander los, wobei sie nichts als Intoleranz, Egoismen und Schweigen verbindet. Die Kraft und der Motor der Sucht bleiben unverstanden. Als Jugendliche fällt der erste nicht stattfindende Kuss einem Urschweigen zum Opfer. Als Mittzwanziger scheitert ein gemeinsamer Ausreißversuch an ihrer beidseitigen Beziehungsunfähigkeit. Sein Zahnputzgurgelgeräusch reicht, um all ihre Zuneigung zu löschen. Im Gegenzug verfällt er in isolierende Migräne, so dass ein Urlaub schon im ersten Autobahnhotel verebbt. Als Erwachsene – nach ihrem Aufenthalt als Studentin in Lyon und seinem Exkurs als Astrophysiker in die USA – hält er für sie ein Familienhaus parat, das natürlich nie ihre gemeinsame Heimat wird. Irgendwann wird sie von ihm schwanger. Er lässt sie sitzen. Sie treibt ab. Auch wenn ihre Ablehnung an dieser Stelle verständlich wird, bleibt unklar, wodurch ihre gleichzeitige Anziehung gespeist wird.
Die Geschichte versandet – als Leser spürt man nur das Knirschen zwischen den Zähnen, nicht aber den bitteren Geschmack der pathologischen Zweisamkeit. Dabei hätte aus der interessanten Konstruktion des Plots etwas werden können. Während im ersten Kapitel in der Ich-Form Albertas Geschichte erzählt wird, führt sich im zweiten Kapitel die Autorin selbst ein, um mit ihrem desinteressierten Gatten Jean-Phillip die Fortsetzung des Romans zu diskutieren. Dieses literarische Arrangement böte die Möglichkeit, die Beziehungsprobleme im Wechselspiel zu beleuchten und im Kräftespiel zwischen Vanderbeke und Jean-Phillip Antworten mit dramaturgischer Eigendynamik zu entwickeln. Leider bleibt der Ansatz auffällig oberflächlich. Es ist nicht erkennbar, was der Jean-Phillip-Exkurs letztlich beiträgt.
Ein Fazit: es gibt nichts Schwierigeres als Beziehungen. Paralysierendes Schweigen ist ihr wichtigstes Merkmal. Eine trübe Vision in einer hier mitunter ermüdenden Version. Note: 3/4 (ur)