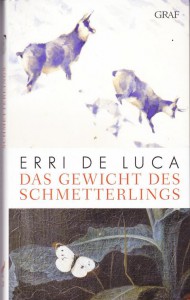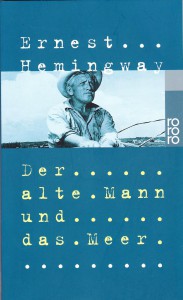>> Der Vergleich drängt sich auf: Geht es in Hemingways „Der alte Mann und das Meer“ um den Kampf eines alten Fischers mit einem gigantischen Schwerfisch, steht der ultimative Zweikampf eines alternden Jägers mit einem übermächtigen Gamsbock im Zentrum von Erri de Lucas „Das Gewicht des Schmetterlings“. Doch anders als beim doch etwas angestaubten Klassiker habe ich mich bei dieser Erzählung keine Sekunde gelangweilt. Es mag an meiner weitaus größeren Affinität zur Bergwelt liegen, aber auch de Lucas Sprache entwickelte bei mir eine besondere Sogwirkung. Wer einmal Gemsen im Hochgebirge beim leichtfüßigen Klettern beobachtet hat, findet Sätze wie “ Die Hufe der Gämse sind die vier Asse eines Falschspielers. Durch sie ist die Schwerkraft kein Gesetz mehr, sondern eine Variante des Themas“ einfach wunderbar.
De Luca verleiht dem mächtigen Gamsbock eine menschliche Persönlichkeit, spricht von seinem Stolz, seiner Tapferkeit, seiner Liebe, seinem Mut, lässt den Leser an den Überlegungen der Gemse teilhaben ( „So wollte er nicht enden“). Dieser kennt seinen Widersacher, den „Mann“, den „Mörder seiner Mutter“ , der ihm schon seit Jahren auf den Fersen ist, ganz genau. Im Dorf, wo er das Fleisch und die Felle der gewilderten Gemsen verkauft, kennt und beschützt man ihn, nennt ihn den „König der Gämsen“, doch der Mann weiß genau , dass dieser Ehrentitel einem anderen König gebürt.
Kurz angedeutet wird die politisch revolutionäre Vergangenheit des Mannes, der sich nach deren Ende in die Berge zurückgezogen hatte und dort seither als einsamer Wilderer lebt und schon über 300 Gemsen erlegt hat. Nur den mächtigen König konnte er bisher nicht erlegen. Die Zeit drängt aber, denn der Gamsbock ist schon alt und würde das nächste Jahr vermutlich schon nicht mehr erleben. Ebenso ergeht es seinem Jäger, auch der sieht sein eigenes Ende nahen. Und so strebt alles unaufhaltsam dem großen showdown entgegen. Das titelgebende „Gewicht des Schmetterlings“ gibt dem Geschehen schließlich eine schicksalhafte Wendung. Ein Hinweis auf die beängstigende Macht des Zufalls, der schmetterlingsleichten Grenze zwischen Leben und Tod. Für mich ein sehr stimmiges Bild und selbst die Verschmelzung der beiden „Er“- Figuren im Tod bleibt unterhalb der Kitschgrenze. Einem Sprachkünstler verzeiht man halt so manches.
Note: 1– (ün)<<
>> „An diesem Novembertag spürte der König, dass sein Untergang nahte“ (S.14) – „An diesem Novembertag spürte der Mann, dass sein Ende nahte“ (S.29). Ein letztes Duell zweier Einzelgänger in der Bergwelt der Dolomiten steht an. Hier der König der Gämsen, ein prächtiger aber in die Jahre gekommener Gamsbock, 20 Jahre unumschränkte Herrschaft über sein Rudel, die brünstigen Weibchen stets zu Diensten, dort der 60jährige Wilderer, in seiner Jugend ein politischer Revolutionär, dann aber enttäuscht in die Berge seiner Kindheit zurückgekehrt, abweisend gegenüber allem Weiblichen . Dieser letzte Novembertag wird von einem Erzähler sprachlich virtuos aus der Perspektive des jeweiligen Protagonisten beschrieben. Seit Jahren war es dem Wilderer mit seiner 300er Magnum und einer Elf-Gramm Kugel nicht gelungen den König der Gämsen zu erlegen. Unfehlbare Witterung und Beherrschung der Szenerie verhindern, dass den König der Gämsen das Schicksal „seiner Mutter“ ereilt. Mit der Personifizierung des Tiers wird die Auseinandersetzung mit „dem Mann“ zu einem Gefecht auf Augenhöhe, ja der König der Gämsen gewinnt gar an Souveränität gegenüber dem Wilderer. Selbst bei letzten „show-down“ verzichtet der Gamsbock auf mögliche Rache – die Tötung des Jägers wäre ein Leichtes gewesen – und ergibt sich mit Stolz dem Todesschuss. Mag auch an einigen Stellen die poetische Sprachgewalt des Guten zu viel sein, de Luca kann einfühlsam beobachten und Natur großartig beschreiben.
Schade nur, dass nicht der Wärmestrom eines weiblichen Dickichts sondern die Zweisamkeit des Eismanns das letzte Wort hat. Das Gewicht des Schmetterlings hätte auch auf dem Horn des Mannes einen würdigen Platz gefunden. Note: 1/2 (ai) <<
>> Erri de Luca als der europäische Ernest Hemingway? Nein – oder vielleicht geringfügig ja, wenn man die beiden Werke „Das Gewicht des Schmetterlings“ und Hemingways „ Der alte Mann und das Meer“ vergleicht. Beide Erzählungen zeigen Parallelen in zahlreichen Strukturelementen, die Handlungskonzepte scheinen einem ähnlichen Grundprinzip zu folgen, wenn auch einmal in den Bergen Europas und das andere Mal in den Meeren Amerikas. In Details der Plots sowie im Sprachduktus verhalten sie sich jedoch wie Fremdsprachen zueinander.
Beide Werke handeln gleichermaßen von willensstarken Mannsgestalten, die den unmittelbaren Kampf mit ebenso fordernden Kreaturen der Natur suchen. In beiden Fällen sind es Einzelgänger mit entrückten Beziehungen zu Frauen, weitgehend losgelöst, teils entfremdet von sozialen Bezügen. Ihr Dasein ist hier wie dort ein schlichtes Überleben in spartanischer Einsamkeit, reduziert auf das Ich vor der eindeutigen Kulisse der Felslandschaften bzw. dem endlosen Meereshorizont. Gemein ist beiden auch das fortgeschrittene Lebensalter und die Todesnähe, die den Drang noch einmal etwas Großes zu tun, wesentlich befördert. Sich am Ende des Lebens zu wissen, verändert die Männer in zweierlei Weise. Zum einen schwindet im Anblick des natürlichen Endes annähernd jede Furcht und erlaubt Grenzen zu ignorieren. Zum anderen ermöglicht dieser Zustand den Zielpunkt ins kaum noch Machbare zu steigern. Entsprechend schwergewichtig muss die Zielgröße sein. Für den Fischer ist es ein Schwertfisch und für den Wilderer ein Gamsbock – in beiden Fällen von noch niemals beobachteter Größe, Kraft und Gefährlichkeit, die die Männer spielend das Leben kosten könnte. Beiden Männer gelingt der Todesstoß, beide eignen sich die Beute an, beide tun dies ohne Reue aber mit Respekt vor dem ebenbürtigen Gegner, und beide verlieren am Ende die erlegte Trophäe: der eine an die Haifische, der andere an den Tod, der ihn überrascht. Soviel zu den Ähnlichkeiten.
Der alte Fischer kennt nur den Wunsch nach einem großen Fang ohne einen wesentlichen Einfluss auf die Wahl des Opfers zu haben. Ganz anders dagegen der Wilderer, der schon seit Jahren gezielt dem König der Gämsen auf der Spur ist. Während der Fischer quasi im schuldfreien Raum fischt, betreibt der Wilderer sein Tun in einer erklärten Verbotszone. Während die Tat des Fischers in erster Linie Lebenserhalt und nur bedingt Ego-Pflege ist, ist beim Wilderer die Gewichtung umgekehrt. Der Mann der Alpen ist anders als der Fischer schon immer ein Rebell gewesen, übrig geblieben und vereinsamt aus den 68er Jahren, geschult im taktischen Kampf und angepasst an ein Dasein im Untergrund.
Ähnlich verschieden sind die natürlichen Gegner. Hier der unbekannte Marlin in der lichtlosen Tiefe des Ozeans und dort der Gamsbock, an dessen Sozialisation der Leser ebenso teil hat wie an seinen ungewöhnlichen Charakterzügen. Während Hemingway den tierischen Gegner weitgehend in der Beschränktheit belässt, wie man ihn über eine Fanglehne eben nur wahrnehmen kann, humanisiert de Luca den Gamsbock und bereitet damit den Zweikampf auf Augenhöhe vor. Der Gamsbock denkt, täuscht, entwickelt Ehrgeiz und zeigt ein Kausalverständnis, wenn er sein Fell in einem Spannungsfeld wenig später einschlagender Blitze auflädt, um seine Flöhe zu verscheuchen. Dieses Tier ist ebenso wie der Wilderer ein Outlaw: unter Härten gereift, Gesetze ignorierend, brutal im Zweikampf, aber dennoch majestätisch und mit ansteckendem Stolz. Der Fischer kämpft mit einer Naturgewalt, der Wilderer gegen eine Identität.
Sehr verschieden ist beiden Werken auch der Duktus: bei Hemingway die ungeschmückte, fast unbekleidete Sprachgebung, bei de Luca das raffinierte Gewand mit überraschenden Accessoires, feinfühligen Metaphern und der belebende Verzicht auf einen ausschließlich gradlinigen Handlungsstrang. Doch leider bügelt de Luca die Wäsche zu heiß, in dem er wiederholt die Grenze zum Kitsch ignoriert. Warum muss ein weißer Schmetterling als Zeiger einer Schicksalsuhr ein halbes Dutzend Mal bemüht werden? Warum muss der Wilderer just nach dem Erlegen des Gamskönigs auch sofort aus dem Leben scheiden? Warum müssen die beiden Todesfälle sogar in einer Umarmung enden, in dem der tote Gamsbock auf dem toten Wilder fest friert, so dass man sie im nächsten Frühjahr mit der Axt trennen muss? Und warum braucht es dann noch zuguterletzt den gefrorenen Abdruck eines weißen Schmetterlings auf dem Horn der toten Gams? (Hier wäre das erotisch offene Ende eines versierten Mitlesers – siehe dort – gehaltvoller gewesen.)
Empfohlen wird dennoch die simultane und damit mehr als additive Lekture des Nobelpreis- und des Petrarca-Preis Werkes. Note: 2– (ur)<<
>> „Der Schmetterling, der Schmetterling, war einmal auch n u r Engerling“, heißt es in einem Gedicht des leider fast vergessen Anton Kreidebleich. Dieser Vers fiel mir während der Lektüre des kurzen Romans ein, weil ein Schmetterling eine schicksalhafte Rolle spielt. Wie im Film, wenn die Musik einen spüren lässt, dass Wichtiges passieren wird, flattert ein weißer Schmetterling durch die Schlüsselstellen, ja begleitet die beiden Protagonisten bis in den Kältetod. Beide, Tier und Mensch wissen und spüren schon früh, dass sie dem Exit nahe sind. Dabei bleibt der Wilderer in seinem selbstmarginalisierten Außenseitertum für mich der sympathischere. Der Gämsenkönig ist einfach ein zu großer Macho.
Die „Humanisierung“, die Vermenschlichung von Tieren, wie sie der Autor hier praktiziert, spricht mich nicht. Ich erlaube mir von einer „Bambisierung“ zu sprechen.
„Die Ziege des Herrn Seguin“ (Alphonse Daudet), die eine nachtlang mit einem Wolf kämpft und erst im Morgengrauen aufgibt, gefällt mir besser. Note: 3– (ax)<<
Epilog
Der Schluss der Erzählung hat nicht alle zufrieden gestellt. Und so wurde zum ersten Mal in der Geschichte des Literarischen Quartetts eine eigene Version (ai) der Schlussszene vorgestellt.
Was würde sie ihm schon entlocken können, diese Frau, die die schamlose Intimität besessen hatte mit ihrer feuchten Hand seinen gegerbten Unterarm zu berühren. Jetzt, da der Mann abendschwer zurückkam in seine Hütte, gab es Gelegenheit nachzudenken, ob denn jenes Gefühl der Vertraulichkeit mit den Bergen ihn unempfänglich gemacht hatte für eine Begegnung ganz anderer Art. Beim Blick zurück stand der Gamsbock noch immer auf dem Felsvorsprung, stolze Kraft, talbewachend. Beim Eintritt In die Stube knisterten die Scheite aus Tannen- und Lärchenholz. Der Gewohnheit folgend lehnte er seine 300er-Magnum an die Ofenbank. Noch vor wenigen Stunden hatte sie den König der Berge gekränkt. Wie konnte ihm auch nach all den Jahren der wildernden Unfehlbarkeit jener Schuss entgleiten, nein, nicht nur fingerbreit, krachend stiebte unter den Vorderläufen der Stein. Der Ostwind schlug gegen das halbgeöffnete Fenster. Er goss sich heißes Wasser in den vom Morgen noch abgestandenen Becher von Felsenrapunzel und fuhr sich mit der Rechten übers Gesicht. Gewehröl und getrockneter Schweiß hatten die Triebe von Ginster und Latschenkiefer überdeckt. Der Mann blieb stehen. Was er jetzt vor sich sah, hatte sich nicht angekündigt wie jener Blitz in den Bergen, der am Boden zunächst sein elektrisches Spannungsfeld aufbaut, bevor er zuschlägt. Er hatte auch keinerlei Witterung irgendeines Parfums wahrgenommen wie vor Tagen drunten als die Journalistin ihn geradezu bedrängt hatte zu ihm hinaufzuklettern. Vor ihm lag hingestreckt auf schwarz glänzenden Lammfelldecken ein Frauenkörper, schutzlos, nackt, begierig fordernd. Der Mann wandte sich ab. Die Gattung Mensch ist mit mangelhaften Sinnesorganen ausgestattet. War er zu rasch abgestiegen, hatte der Fehlschuss die Sinnestäuschung ausgelöst. Hatte nicht oben nachdem die jungen Böcke ihre Kräfte maßen einer, ohne von den anderen bemerkt zu werden, in der ersten Hitze eine Geiß bestiegen. Noch Stunden danach nimmt der Mensch den Mandelgeruch wahr, der ihren Geschlechtsdrüsen hinter den Hörnern entströmt. Der Mann hatte nicht die Zeit die Wahrscheinlichkeit des Augenblicks zu überprüfen. Es zog ihn hin. Er fühlte sein schwellendes Horn eingegraben in den samtenen Unterschlupf, einem sicherlich nicht gänzlich unberührten Dickicht. Kein Rudel weit und breit. Zweisame Einsamkeit wie er sie noch nie erlebt hatte – wortlos. An diesem Novemberabend spürte der Wilderer, dass sein Ende nahte. Sein Unterarm blieb unberührt. War es das Abendgeläut einer fernen Glocke oder der Flügelschlag eines weißen Schmetterlings, den er noch wahrnahm.