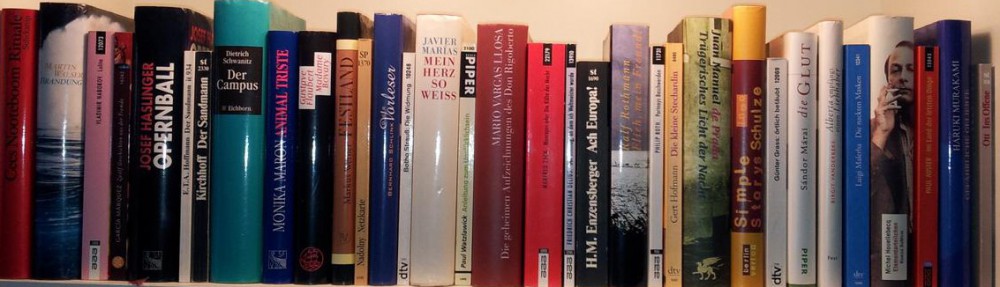>>Deutscher Buchpreis 2024, die Latte liegt hoch. Da kann die Kritik auch schon mal heftig ausfallen. Dieses Buch reißt die Latte nicht, es läuft unten durch. Ich werde den Verdacht nicht los, dass andere, literaturfremde Gründe eine Rolle bei der Vergabe gespielt haben: Die Autorin, eine Frau aus der freien, linken Theaterszene Leipzigs, die den woken, mutmaßlichen Zeitgeist bedient. Es geht viel um Tatoos, da wird im Text gegendert, da ist – ernst gemeint von einer „Performerin, weiblich gelesen“ die Rede. Das ist selbst in der immanenten Genderlogik, mit Verlaub, offensichtlicher Blödsinn. Die Love-Scammer aus Nigeria, die unzählige Frauen ins finanzielle und emotionale Unglück stürzen, ernten viel Verständnis, rächen sie sich doch an den Nachfahren der ehemaligen Kolonialmächte. Kritische Recherchen dazu werden beiläufig abgetan. („Was soll man von SPIEGEL TV auch erwarten“). Das Ballett ist natürlich „kolonialer als die stärkste Kolonialmacht, weil es immer an weiße Körperideale“ geknüpft ist. Bei geschilderten Fahrscheinkontrollen in Leipzig beobachtet sie, wenig überraschend, latenten Rassismus. Das ganze Buch dann selbstredend von einem „Sensitivity Reader“ geglättet, der die Autorin auf „verborgene Machtgefälle und Diskriminierungen aufmerksam machte“, wie die Autorin in einem umfangreichen Nachwort bekennt.
>>Deutscher Buchpreis 2024, die Latte liegt hoch. Da kann die Kritik auch schon mal heftig ausfallen. Dieses Buch reißt die Latte nicht, es läuft unten durch. Ich werde den Verdacht nicht los, dass andere, literaturfremde Gründe eine Rolle bei der Vergabe gespielt haben: Die Autorin, eine Frau aus der freien, linken Theaterszene Leipzigs, die den woken, mutmaßlichen Zeitgeist bedient. Es geht viel um Tatoos, da wird im Text gegendert, da ist – ernst gemeint von einer „Performerin, weiblich gelesen“ die Rede. Das ist selbst in der immanenten Genderlogik, mit Verlaub, offensichtlicher Blödsinn. Die Love-Scammer aus Nigeria, die unzählige Frauen ins finanzielle und emotionale Unglück stürzen, ernten viel Verständnis, rächen sie sich doch an den Nachfahren der ehemaligen Kolonialmächte. Kritische Recherchen dazu werden beiläufig abgetan. („Was soll man von SPIEGEL TV auch erwarten“). Das Ballett ist natürlich „kolonialer als die stärkste Kolonialmacht, weil es immer an weiße Körperideale“ geknüpft ist. Bei geschilderten Fahrscheinkontrollen in Leipzig beobachtet sie, wenig überraschend, latenten Rassismus. Das ganze Buch dann selbstredend von einem „Sensitivity Reader“ geglättet, der die Autorin auf „verborgene Machtgefälle und Diskriminierungen aufmerksam machte“, wie die Autorin in einem umfangreichen Nachwort bekennt.
Ein bisschen Namensgebung aus der römisch-griechischen und ägyptischen Mythologie (Jupiter, Juno, Benu) für die Protagonisten und der als Klammer wirkende, düstere Lars von Trier Film Melancholia, reichen nicht aus, der Geschichte wirklich Tiefe zu geben. Es hätte eine spannende Geschichte werden können. Berührende Ansätze über das Gefühl von Juno eine Außenseiterin zu sein in Kindheit und Jugend gibt es schon. Aber bei den Dialogen mit dem schnell entlarvten Love-Scammer Benu stellt sich trotz vieler „Tränenlachsmileys“ rasch Langeweile ein. Sie bleiben oberflächlich, man erfährt fast nichts über ihn. Der Roman tritt auf der Stelle. Oder ist die Ödnis Programm?
„Ein Roman, der sein Versprechen nicht einlöst“, urteilt Katharina Teutsch im Deutschlandfunk. Da kann ich mich anschließen.<< Note 5+ (ün)
>> In Martina Hefters Roman grüßt mit aufweckendem Grundton die in prekären Verhältnissen lebende Protagonistin Juno. Sie grüßt nicht nur ihren schwerkranken Lebenspartner und einen virtuell-realen Nigerianer im Social Media Universum, sondern auch sich selbst. Es ist ein motivierendes Atmen, während der Feinstaub schicksalhafter Nebel sich schon lange in ihrem Umfeld festgesetzt hatte. Ihr Partner, von fortgeschrittener multipler Sklerose gezeichnet, ist zwingend auf ihre Hilfe angewiesen. Der gemeinsame Lebensunterhalt ist für sie als freischaffende Künstlerin nicht garantiert. Das Selbstwertgefühl der gut Fünfzigjährigen auf der Ballettbühne wird immer mehr in Frage gestellt. Es ist ein atemloses Hasten vor dem Bühnenbild ihres Dasein. Und doch findet Juno und das Geschehen dieses Plots festen Halt. Ja, er bleibt am Ende mit einer hellen Aura in Erinnerung des Lesers ohne kitschig zu werden.
Vordergründig gruppiert sich das Geschehen um einen Internet Dialog. Es ist eine andere Bühne. Juno füllt die schlaflosen Nächte mit provozierenden Abenteuern auf Internet-Kontaktbörsen. Sie wirft die Angel aus, bietet sich als kleinen Frischfang, um im nächsten Moment die anbeißenden Männer bloßzustellen. Es ist ein Wechselspiel auf Augenhöhe. Die Lüge ist der Ball, den sich beide Seiten zuwerfen. Die Männer/Frauen/Diverse tragen Fake-Namen, leben im Fake-Luxus, machen Fake-Versprechungen. Am Ende wollen sie Geld oder Sex oder beides. Juno dagegen will Unterhaltung. Was zunächst nur als Ablenkung begann entwickelt Suchtcharakter.
Überraschend gewinnt einer dieser Kontakte an Stabilität und macht eine Metamorphose durch. Um das anspruchslose Zwiegespräch zwischen Juno und dem Nigerianer Benu sortiert die Autorin ein zunehmend komplexer werdendes Psychogramm der Protagonistin. Juno sendet Stichworte an Benu. Diese sind vor allem Aufhänger für die eigenen Gedankengänge. Über den Fremden im Äther geht Juno immer stärker auf sich selbst zu. Schleichend gibt sie immer mehr von sich preis – so wie Benu offensichtlich auch von sich. Ihr Misstrauen wird schließlich von Zuneigung verdrängt. Es wird in dem Moment laut und vernehmlich, als Benus Profil auf der Love Scammer Plattform leer bleibt. Am Ende erscheint diese Virtualität selbst virtuell. Realer wird gleichzeitig Junos In-sich-Ruhen. Der zerstörerische Planet Melancholia entschwindet aus ihrem Horizont.
Mit dem Fortschreiten der Seitenzahlen rahmt Martina Hefter die kurzen Internet-Dialoge immer mehr durch auktoriale Erzählstränge ein. Die Tiefenschichtung der Gestalt Juno tritt zunehmend an die Oberfläche. Rückblicke in die holprige Kindheit. Alltagserschöpfung im Hier und Jetzt. Aufopferung für den genügsamen Partner. Erfüllung im kreativen Tanz. Ihre nächtlichen Ventile für den seelischen Überdruck. Wir beginnen den Menschen Juno zu kennen.
Juno war früh die Außenseiterin. In der Schule gemieden, sich nicht einfügend. Ein bisschen Punk, ein bisschen Frühintellektuelle. Die extravaganten zerschlissenen Klamotten, das vorzeitige Eindringen in die Astrophysik, die irrwitzige Begeisterung für das Ballett. Freie Theatertätigkeit am Existenzminimum, Liebschaften, keine Kinder, aber einen lieben Jupiter, ihr kranker Lebenspartner. Noch jetzt kreisen die Himmelskörper mit stabiler Gravitation umeinander.
In diesem Lebenslauf werden auch Werte neu justiert. Lüge. Wahrheit. Love Scamming ist Lüge. Oder wird nicht auch das angeboten, was der Selbstwahrnehmung – vielleicht auch der Selbstlüge – entsprechen soll? Was ältere Frau vom fremden Mann hören will? Dass es eine Restattraktivität gibt.
Oder das Ballett. Auch nur eine Fälschung jenseits der Wirklichkeit. Bilder ohne Realität. Oder, die von Juno bemühten und in den Sternbildern verewigten Mythologien. Sentenzen der Unwirklichkeit. Der Lüge? Ist Fantasie Lüge? Und wenn ja, braucht Wahrheit dann nicht immer wieder eine ordentliche Portion davon? Juno ist mehr als eine nächtliche Love Scamming Kandidatin.
Dass all das nicht ohne Schwermut ist, ruft Hefter auch mit einem wiederkehrenden Motiv in Erinnerung. Der Kinofilm Melancholia: ein vagabundierender Planet zerstört die Erde. Nicht zerstört wird bis zuletzt die Nähe zweier Schwestern. Und das just in dem Moment, wo die eine gerade heiratet. Juno ist fasziniert von dem Film, weil er nichts beschönigt. Hier also ohne Lüge. Aber ohne Fortsetzung. Immerhin hat die Melancholie ein Ende.
Zu guter Letzt ist erstaunlich (aber ermutigend), dass dieser Roman Anerkennung in Form des Deutschen Buchpreises findet, obwohl das Ende nur bedingt offen ist und vieles sich zum Positiven wendet. Junos erste eigene Ballettinszenierung wird bejubelt, Jupiters Romanmanuskript findet ein großes Verlagshaus, ein Buchpreis entschärft die Finanzsorgen, Jupiter kehrt nach einem erneuten MS Schub stabilisiert aus dem Krankenhaus zurück. Fast eine undeutsch positive Machart. Befremdlich bleibt jedoch die (Buchpreis-förderliche?) auferlegte Zensur. Mit Dank erwähnt die Autorin das sensitivity reading, und meint damit die auswärtige Sprach- und Inhaltskontrolle ihres Werkes, um allen Gender-, Rassismus- und antizipierten Kritikpunkten der lesenden Öffentlichkeit gerecht zu werden. Der Pfad zur Rasterliteratur? Auch wenn diese Form der vorauseilenden political correctness correction wie eine Verpflichtung zum main stream klingt, bleibt dennoch genügend Lesestoff. Note: 2 – (ur)<<
>> Lieber als jetzt über ihr Buch zu schreiben, hätte ich ihre multimediale Performance „Soft War“ in der Dependance des Leipziger Schauspielhauses angeschaut. Aber alle sieben Vorstellungen waren ausverkauft.
Also doch zum Buch, auf dessen Rückseite zu lesen ist „Martina Hefter hat ein göttliches Buch geschrieben“ (FAZ). Das steigert die Vorfreude. Der Inhalt des Romans ist dem Lesenden sicherlich bekannt. Es gewährt wertvolle Einblicke in das Leben kulturschaffender Menschen, die am unteren Existenzminimum leben und auf den großen Durchbruch hoffen. Überraschend auch, wie selbst diese Welt von Bürokratie geprägt wird. Wäre ich im Tätowiergewerbe tätig, würde ich das Buch kostenlos verteilen. Soviel kostenlose Werbung in einem Buch für eine problematische Körperverletzung. Eher ärgerlich. Die Rechtfertigung der afrikanischen Love-Scammer mit der früheren kolonialen Ausbeutung des afrikanischen Kontinents ist problematisch.
Lesen bildet: Ich weiß jetzt, dass ein Tränenlachsmiley nichts mit Lachs zu tun hat und dass das Sturzbächeweinen-Emoji sparsam verwendet werden sollte.
Sympathisch finde ich, dass die Autorin am Ende auf anderthalb Seiten „vielen wunderbaren Menschen“ für ihre Begleitung dankt. Note: 3 (ax)<<
>>Da wird ein Roman gehypt (Die FAZ spricht von einem „göttlichen Buch“), aber der Leser wird enttäuscht. Dabei sind die zwei Welten der Performancekünstlerin Juno mit ihrem MS erkrankten Mann Jupiter und die vorwiegend nächtliche Gegenwelt der Scamming- und Chatszene mit der Schlüsselfigur Benu eigentlich Stoff für eine große Geschichte. Stattdessen bilanziert die allwissende Erzählerin nüchtern: „Juna Isabella Block schreibt immer morgens zwischen sieben und acht im Bett, wenig später geht’s los zum Tanzen, manchmal schreibt sie auch abends und nachts. Einen Text über Tattoos, den Planet Melancholia, über ältere Frauen, Love-Scammer, Nigeria.“ (129). Diese Zusammenfassung hätte sicherlich nicht zum Deutschen Buchpreis gereicht. Heutzutage dagegen all das, was sich unter der Kategorie „Zeitgeist“ und „woke“ subsummieren ließe. Dazu hätte es allerdings nicht des peinlichen Schlussdanks der Autorin bedurft. Wer selbst zum Schreiben einen „Sensitivity Reading“ Coach (weiblich gelesen!!) benötigt, der sollte es beim Tanzen belassen. Note: 4 (ai) <<