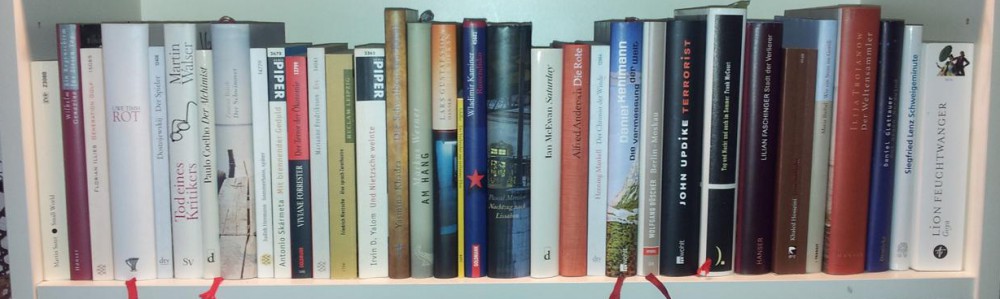Steidl Verlag (1969) – 283 Seiten
>>Grass diagnostiziert in Örtlich betäubt eine literarische Multimorbidität, deren zeitgeschichtliche Symptome auf einem zahnärztlichen Behandlungsstuhl sediert werden. Intoniert von einer kieferkranken Pädagogengestalt. Mit Betonung der immer nur kleinen Schritte im Konfliktfeld der Gegenwart. Eben die Tretmühle der Vernunft. Formal kleidet der Autor die Gedanken in assoziative Gewitter, woraus sich eine unübersichtliche Wetterlage für den Leser entwickelt. Streckenweise durchaus originell, im Ganzen jedoch unterkühlt. Auf einen Handlungsstrang verzichtet Grass weitgehend. Ja, man kann die Orientierung verlieren und sich im Kreise drehen. Ist das Zeitkritik?
Der Hauptprotagonist Starusch, Gymnasiallehrer für Deutsch und damit auch Geschichte, steht im Widerstreit mit seinen diffus progressiv politischen Ansprüchen. Geprägt von den Umwälzungen der 68er-Jahre und der inzwischen angepassten Rationalität, die neben jedem Für auch mit einem Wider liebäugelt. Wie in einem bewegten Stillstand verfangen. Sein literarischer Gegenpol ist der Schüler Scherbaum. Sympathisch, intelligent, politisch entflammt für Gerechtigkeit und radikalisiert durch seine Freundin Vero. Um die Berliner gegen Napalm und den Vietnamkrieg aufzurütteln, plant er seinen Dackel auf dem Kudamm zu verbrennen.
Verbrennen oder nicht verbrennen bleibt die durchgängige Frage. Der Selbstredner Starusch monologisiert in Rückenlage während einer langwierigen Kieferbehandlung. Dabei purzeln unter dem Einfluss wiederholter Lokalanästhesie autobiographische Elemente, Personen und Visionen assoziativ durcheinander und hinterlassen verwaschene Engramme. Zahnärztlicher Eingriff und die als Dialoge verkleideten Diskurse teilen die Monotonie, nur unterbrochen vom gelegentlichen Murmeln des behandelnden Arztes.
Interessante Einflechtungen stellen lediglich Aspekte der Familie Krings dar, mit der Starusch fast verwandt geworden wäre. Vater Krings war Zementbaron und hartgesottener Militarist. Als Ex-Feldmarschall gehasst, dann kriegsgefangen, schließlich heimgekehrt. Tochter Linde war Verlobte von Starusch bis die Beziehung auseinanderbrach. Auslöser des Zerwürfnisses war die Liaison mit Elektriker Schlottau. Schlottau diente als Gefreiter unter ihrem Vater. Linde hoffte nun – über den nur im Stehen praktizierten Sex – von Schottau Hintergründiges über ihren Vater zu erfahren. Der Liebesverlust entfachte in Starusch farbenfrohe Mordphantasien, ohne dass es zum Vollzug gekommen wäre.
Der Seitensprung wurde weiter ins Absurde verfremdet, in dem sich das neue Paar mit aller Inbrunst von der Wertewelt des Feldmarschalls absorbieren ließ. Ins Groteske gesteigert, stellten sie am Ende zu dritt in naiv-befremdlicher Weise in riesigen Sandkastenspielen Details des Russlandfeldzuges nach. Mit veränderten Strategien müsste der Krieg nachträglich doch noch zu gewinnen sein. Der Militarismus ging viral.
Der Roman bewegt sich nicht, und er bewegt nichts. Auch prosaisch bleibt er betäubt. Es scheint Schmerz da zu sein, aber unter örtlicher Betäubung wird er weder gespürt, noch hat er Konsequenzen. Die Zahnbehandlung ist abgeschlossen, doch der Kiefer bereitet neue Probleme. Der Hund wird nicht verbrannt. Die kleine Pseudoterroristin Vero heiratet einen anderen und wird Stammgast in angesagten Kudamm Konditoreien. Die Lehrerkollegin Seifert gebiert sich als selbstkasteiender Erzengel samt Schuldanspruch mit unbegrenzter Haltbarkeit. Nachträglich entsetzt über ihre früheren BDM-Aktivitäten im Nazideutschland, ist für sie jetzt der Schüler Scherbaum Zukunftshoffnung und moralisches Idol. Doch ihre Selbstempörung erweist sich als labil. Die überschießenden Heilserwartungen an den Schüler und die Zeitenwende zerbröseln augenblicklich als das Hundeopfer aus dem zeitgenössischen Programm gestrichen wird. Auch Scherbaum sieht die Dinge inzwischen relativierter.
Der Roman kann als Gesellschaftskritik verstanden werden in einer Zeit, in der politische Aufarbeitung historischer Verbrechen weitgehend ausbleibt. Eine Zeit, die davon lebt, Zusammenhänge zu relativieren, intellektuell zu versanden und deshalb zu paralysieren. Betäuben. Aber eben nur örtlich. Ernst gemeint, aber literarisch nicht wirklich gelungen. Note: 3/4 (ur)<<