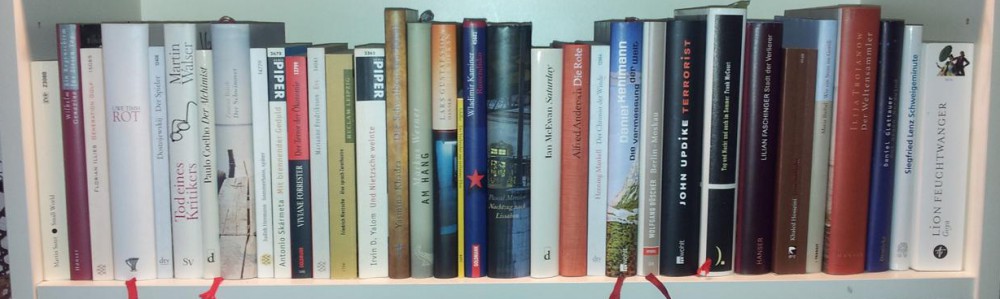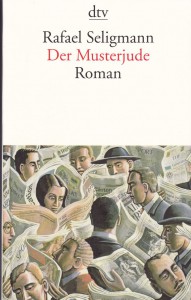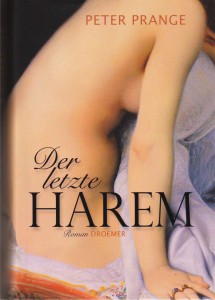>> Vom Aufstieg und Fall des Moische Bernstein erzählt der Roman. Bernies Jeansshop ist Ausgangs- und Endpunkt einer wahrhaft turbulenten Karriere im deutschen Pressewesen. Den gnadenlosen Gesetzen des Zeitungsmarktes folgend, in dem das hire and fire-Prinzip den auch verbal knallharten Ton angibt, mausert sich der bis zum Schluss unter der unerbittlichen Fuchtel seiner jidische Mamme Hanna stehende Moische vom Looser zum Chefredakteur und Starkolumnisten zweier Erfolgsgazetten „Logo“ und „German Today“. Den „Juden“-Bonus wie die Unfähigkeit des „Goj“ zur Aufarbeitung der Vergangenheit gleichermassen schamlos missbrau-chend, fegt Moische auf der Welle des Erfolgs und lässt skrupellos eine Spur von schreibende Karriereopfern hinter sich (Keller, Reydt Wimmer), bevor sein eigener Zögling Frank Lackner zum Brutus wird. Auch inhaltlich bedient uns Seligmann statt mit seriösem Journalismus mit Einblicken in die Hexenküche nicht nur des Boulevards: Taschenspielertricks, etwa Moisches „aufgejudeter Name“ Moische Israel Bernstein der dem Kolumnisten den Hauch der Unangreifbarkeit verleiht. Vermeintliche Leserbefindlichkeiten werden schonungslos bedient „Die deutschen Mörderseelen sind süchtig nach jüdischen Themen“. Der tägliche Aufmacher, die Schlagzeile wird zur auflagengeilen Kampfparole. Sprache und Denken in den Redaktionstuben sprengen alle ethischen Grenzen:„Schreib mir die kulinarische Todesfuge“. Nicht seine eigenen zuweilen auch denunziatorischen Methoden bringen Moische Bernstein zu Fall, die von seinem ehemaligen Ziehvater Heiner Keller lancierte Enthüllungsgeschichte „Ein falscher Jude“ erweist sich nach einem wohlinszenierten tränenreichen Fernsehauftritt Bernsteins und seinem mitleiderheischenden Appell „Ich fordere Menschlichkeit“ als Rohrkrepierer, sondern die schnöden Gesetze des Marktes. Reichlich unvermittelt wie sein Aufstieg ist auch sein Fall. Der amerikanische Verlagsleiter und seine Geldgeber (Klischee?) sprechen das Urteil: „Du bist der Wirtschaft und ihren Werbefritzen nicht mehr vermittelbar“. Dem Leser wenig vermittelbar ist auch ein ganz anderer „Phall“. Moisches Frauen, ob als „Schicksen“ denunziiert oder jüdischer Provenienz scheinen eher dem Wunschtraum eines sehr schlicht geratenen Männerbildes als der Wirklichkeit entsprungen. Hier scheint dem Autor vor allem in der Judith-Gabi-Moische Episode der Schmok durchgegangen zu sein. Für diesen sprachlich eher schlichten Intrigantenstadel deutscher Medienlandschaft, ob überzeichnet oder nicht mögen Insider urteilen, eine 2,5. Für die jidische Mamme, die nach Seligmann alles andere als ein jüdisches Mutter-Zerrbild darstellt, einen Sonderpunkt. Note: 2,5 (ai)<<
>> In Auschwitz zu „I will survive“ tanzen – darf man das? Ja man darf, allerdings nur wenn man selbst Überlebender des Holocaust ist. Großajatollah Henrik M. Broder hat seinen Segen gegeben. Sein Urteil über den „Musterjuden“ von Seligmann fällt weniger großzügig aus. Seligmann biedere sich seiner Meinung nach zu sehr bei den „Deutschen“ an, verleiht ihm gar den Negativpreis „Schmok des Tages“. Meine Einwände sind andere:
Die Innenschau in die Mechanismen und Redaktionskonferenzen der Medienbranche ist trotz oder wegen der zuweilen grotesken Übertreibungen erhellend, witzig und wohl nicht so weit von der Wirklichkeit entfernt. Vor allem in der zweiten Hälfte des Buches liest sich dies rasant und kurzweilig. Ob es ihm allerdings gelingt wie versprochen, das deutsch-jüdische Verhältnis zu entkrampfen, bleibt eher zweifelhaft. Vieles wirkt doch klischeehaft. Die massenhafte und letztlich wenig motivierte Verwendung jüdischer Ausdrücke wie „Schickse“ nervt doch zunehmend. Literarisch bleibt die Figur des Moische Bernstein seltsam ambivalent und trudelt zwischen genialischem Hochstapler und Witzfigur.
Note: 3+ (ün)<<
>>Das Buch schildert Aufstieg und Fall des Moische Bernstein. Vom Jeansverkäufer zum Chefredakteur und viceversa. Insgesamt bleibt es etwas rätselhaft, wie dieser fulminante Aufstieg überhaupt gelingen konnte. Die Mutter hält ihn für einen Versager und wer Moische in seinem Jeansladen erlebt , sieht in ihm nicht den strategischen Kopf, der ein Massenblatt dynamisch leiten kann. Im Mittelpunkt steht das immer noch komplizierte deutsch-jüdische Verhältnis. Was witzig und ironisch gemeint ist, wirkt aber immer wieder grenzwertig und vor allem: es wieeeeederholt sich. Darf ein Jude Tabus verletzten, die für einen Deutschen tabu bleiben müssen/sollten? Das zweite zentrale Thema ist die deutsche Medienlandschaft, die unter amerikanischen Finanzeinfluss gerät. Sie wird eher in Form einer Posse abgehandelt. Hier geht es vor allem um Auflagensteigerung um jeden Preis. Dazu wird vor keiner Geschmacklosigkeit zurückgeschreckt (Erfindung KZ-Kochbuch zum Beispiel). Alles begleitet von Kabalen und Komplotten ohne Ende. Der Leser wird gezwungen, seinen Wortschatz zu erweitern. Schmock&Schmonzes werden ihm zu vertrauten Worten, ebenso die unterschiedlichen Aggregatzustände, in die sich ein Schmock verwandeln kann. Dann vielleicht doch lieber gleich richtige Comedy, wie die vom jüdischen Komiker Oliver Polak: „Ich darf das, ich bin Jude“. Note: 3+ (ax)<<
>>Moische alias Manfred alias Israel Bernstein ist Jude und Nichtjude, Spielball in einem real-absurden deutschen Medienschlachtfeld, ist Feldmarschall, Rekrut, Überläufer, Demagoge und spektakulärer Verlierer. Moische Manfred Israel Bernstein wird zur Projektionsfigur des von Auschwitz genährten deutschen Schuldgefühls, ist die stilisierte, ständig ersehnte Opfergestalt, die der jüdische Autor Seligmann dem deutschen Leser als großen Manipulator der nationalen Empfindlichkeit an die Seele nagelt. Was passiert hier?
Moische lebt seit Jahren als Verkäufer mit seiner mental stoßfesten Mutter in antagonistischer Symbiose von einem kleinen Jeansladen. Auf dem journalistischen Parkett ist Moische bisher nur ausgerutscht bis sein alter Schulfreund Heiner ihn für einen Artikel zum ausgewählten Thema Küchengeheimnisse aus dem KZ anheuert. Die Grundidee: Tabuthemen in unklar semitische/nazistische Nebelschwaden gehüllt als reißerische Unterhaltung auf den Markt werfen und eine breite Zustimmung sichern, indem der Autor sich als bekennender Jude outet. Das Konzept schlägt ein wie eine Bombe. Mit olympisch philosophischen Ambitionen sieht Moische sich schon bald als nationalen Vordenker.
Der Chefredakteur des Magazins mit dem bezeichnend inhaltlosen Namen logo! versteht dem öffentlichen Geschmack zu entsprechen, spürt den gelangweilten Konsumdruck des Publikums und modelliert entsprechend alle Komponenten. Moisches Konterfei als Beiwerk zu seinen Artikeln wird mit jüdisch schweren Lidern aufgepeppt, sein Name mit dem Zweitnamen Israel „aufgejudet“ (S. 77) und der Storytitel mitten ins Holocaust Herz gestoßen: „Droht ein neues Auschwitz?“. Den ständig steigenden Druck-Auflagen folgen ebenso rasant grassierende Radiosendungen und Talk-Shows, die durch gezielte Vorabinformationen an die Sender die Medienpräsenz katalysieren.
Bizarre Konfrontationen fördern weiter das Geschäft als die berühmte Fatima Örsel-Obermayr als Vorkämpferin für die Rechte ausländischer Mitbürger Moische angreift. Juden würden das Leidensmonopol für sich beanspruchen, während Ausländer in Deutschland angeblich nur Freude hätten. Den heftigen Angriffen ist Moische noch nicht gewachsen. Er bricht heulend zusammen und muss von seiner Mutti nach Hause gebracht werden. Die Nation ist angesichts solch vermeintlich antisemitischer Gemeinheiten entsetzt und wird fortan nicht nur Fatima Örsel-Obermayr ächten, sondern auch Moische mit Inbrunst huldigen. Örsel-Obermayr hatte ein deutsches Tabu gebrochen: sie hatte versucht die Deutschen ihrer Lieblingsopfer zu berauben (S.87).
In dieser Phase beginnt die inter- und intraredaktionelle Schlammschlacht, die – wie wir lernen – prinzipiell keine Grenzen kennt. Heiner stachelt jetzt Moische an seinen Chefredakteur wegen (Über)-Fälschung seiner Artikel erfolgreich auf Schmerzensgeld zu verklagen. Sofort wechselt Moische zusammen mit Heiner zum neuen Konkurrenzblatt Germany Today. Nachdem es ihm gelingt den dortigen Chefredakteur zu liquidieren und den Posten zu übernehmen, entsorgt er auch seinen Freund Heiner in die Leserbrief-Redaktion, bevor er ihn ganz rausschmeißt. Als Moische dann an einem eigenen Denkmal bastelt und ein Zweitblatt gegen den Willen des amerikanischen Managements aufmachen will, wird er von einem seiner Zöglinge verraten und augenblicklich beerbt. Allerdings wird auch dieser schon wenig später kaltgestellt und ersetzt. Wie das unendliche Wirken der Gezeiten spülen die Fluten frisch angewachsene Meeresfrüchte aus bei Ebbe trocken gelaufenen Becken. Und es nimmt nie ein Ende. So überzeichnet und erschreckend amüsant gerade dieser Teil ist, so beeindruckt wird der Leser von der nackten Grausamkeit der Medienlandschaft.
Moische steigert sich zunehmend in einen demagogischen Publikationsstil, definiert die redaktionelle Pflicht, Emotionen zu schüren, ignoriert Wahrheiten und polarisiert durch eine perfide Mischung aus Halbwissen und Gerüchten, wiegelt auf und entfacht das ganz große populistische Sperrfeuer mit einer Anti-Steuerkampagne für Branntwein, Tabak, Getränke, Mineralöl und andere Konsumgüter des kleinen Mannes. Die kumulierenden Kampagnen führen nicht nur zu steigenden Aktienkursen einschlägiger Industriezweige, sondern sogar zum Rücktritt betroffener Minister. Bei alledem entpuppt sich Moische als fette Spinne in einem Netz, an dem Unzählige munter mitspinnen und sich auf ihre Art bereichern. Es gibt tatsächlich keine Unschuldigen. Schuld scheint das Lebensmotiv, ja das Leben an sich zu sein.
Dies gilt auch für alle Frauengestalten. Sei es die von anti-deutschen Hassgefühlen getriebene Mutter, sei es die Moische ergebene Volontärin Cordula, die durch sexuelle Breitbeinigkeit deutsche Schuld zu sühnen sucht, sei es die reichste, schönste Jüdin Berlins Judith, die mit ihrem halbwüchsigen Sohn fürsorglich das Bett teilt, so dass ihre nazistisch durchsetzten Schuldgefühle nicht aber Moische auf ihrem Kissen Platz finden.
Seligmann ist eine laute, knallbunte Realsatire gelungen, in der die tägliche Gewalt des Medienlebens und der historische Masochismus deutscher Intellektueller gekonnt mit einander verflochten sind. Der Kulminationspunkt wird erreicht als der bekennende Jude Moische als Sohn eines Nazischergen entlarvt wird. Seligmann setzt sogar noch eins drauf: die deutsche Schuldbedürftigkeit lässt die Liquidierung des Schuldobjekts Moische nicht zu und rehabilitiert ihn. Stattdessen wird der Urheber der Aufdeckung vernichtet.
Wie absurd und real doch alles erscheint. Vor allem wenn sich zu guter Letzt der Leser vor Augen hält, dass solch eine Satire nie von einem deutschen Pharisäer hätte geschrieben werden dürfen.
Kurzweilig, erhellend, nachdenklich, voller Schundroman-Dynamik, aber sicher keine große Literatur. Note: 2– (ur)<<