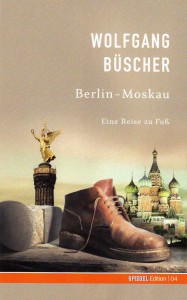Hoffmann und Campe 2008, 128 Seiten
Hoffmann und Campe 2008, 128 Seiten
>>Man muss sein Urteil über dieses Buch auch mal verschweigen dürfen. Note: 4+ (ai)<<
>>Schweigeminute ist ein angemessener Titel auch für den Kommentar: in der Tat möchte man aus Rücksicht über diese Novelle kaum Worte verlieren. Ein zu kleiner Erzählkreis, der sprachliche Raffinesse sucht aber nicht findet. Ein schon gekanntes Melodram: Schüler und Lehrerin verlieben sich bis dass der tragische Tod sie scheidet. Wenig Tiefe in den Gefühlsgründen und manchmal bemühte, fast befremdliche Konstruktionen wie am überaus enttäuschenden Schluss, wo man hofft, dass der wohlgediente Lenz die Sieltore nun schließen möge, damit die alten fruchtbaren Weidegründe nicht im Brackwasser untergehen. Doch es gibt auch von gelegentlichen frischen Winden aus dem Küstenwerk am Rande der Ostsee zu berichten.
Hirtshafen, kleiner Küstenort mit Badegästen, Schülerregatta, bodenständigen Charakteren und der schön-sportlichen und unkonventionellen Englischlehrerin Stella Petersen. Stella verguckt sich still aber direkt in Christian, ihren 18-jährigen Schüler wie auch er in sie. Die Annäherung erleben wir wie das Ansteigen des Meeresspiegels bei auflaufender Flut: eher unauffällig bei Stella und mit Erlebniswellen bei ansonsten ruhiger See bei Christian, der uns mit wenig überzeugender Sachlichkeit die Begebenheiten schildert. Gemeinsame Badeerlebnisse, Ausflüge auf die einsame Vogelinsel, Dünenkuschelei, Strandsommerfest, eine gemeinsame Hotelnacht im Heimatort und alles vor den Augen der interessierten Nachbarschaft. Kaum nachvollziehbar die weit verbreitete Gelassenheit der Akteure und ihrer Voyeure, was wie eine wenig gekonnte literarische Nachlässigkeit anmutet. Mit zunehmender Liebelei gewinnen die Träumereien von Christian an Farbe, während sich Stella schon mal über die Normverletzung ihres pädagogischen Fehltritts sorgt. Christian hortet währenddessen Eingemachtes, um mit Stella auf der Vogelinsel in Einsamkeit und Liebe aber ohne Hunger dem Glück zu frönen. Stella übt zwischenzeitlich eingeschränkte Distanzierung mit schlechten Noten für seine mäßigen Englischleistungen. Dennoch wird ihre Liebe bis zum Ende durchhalten.
Eingeflochten erscheinen Momente des Todes. Bei der kleinen Segelregatta rettet Stella einen Schüler aus einem gekenterten Dingi, verteidigt ein Mädel unter Wasser gegen einen rivalisierenden Mitschüler, pflegt ihren sterbenskranken Vater und stirbt bei einem Segeltörn dann doch als erste. Spätestens an dieser Stelle böte sich ein literarischer Tiefgang als Stellas Segelboot verunglückt. Christian hatte mit seinem Vater, der „Steinfischer“ ist, von einem uralten Unterwassersteinwall Steine zum Hafen transportiert, um dort einen schützenden neuen Wellenbrecher aufzuschütten. Im Mittelalter provozierten die künstlichen Wälle, die bis kurz unter die Meeresoberfläche reichten, das Auflaufen fremder Schiffe, damit die Küstenbewohner sich anschließend am angeschwemmten Strandgut bereichern konnten. Kollektiver Mord mit langlebiger Infrastruktur. Die Tragik liegt in der Tatsache, dass der Abbau der alten und Aufbau der neuen Barriere Leben retten sollte. Doch das Gegenteil geschieht, als sich das Segelschiff bei Sturm in den rettenden Hafen flüchten will, sich am Wellenbrecher verfängt und der brechende Mast Stella erschlägt. All dies wird von Christian beobachtet. Zwar kann er sie noch lebend retten, doch stirbt sie später an ihren schweren Kopfverletzungen. Enttäuschend, dass die Novelle auch hier kaum mehr als eine unreflektierte Unfallbeschreibung liefert. Dann Schülerbesuch im Krankenhaus, schulische Trauerfeier und Seebestattung, Ende.
Letztlich ein auch bei stürmischer See leicht verdauliches Buch, das mehr durch seine Kürze als durch seinen Gehalt überzeugt. Note: 3/4 (ur)<<
>> Nicht jedes Alterswerk ist meisterlich, auch wenn der Autor einen großen Namen wie Siegfried Lenz trägt. Trotz gekonnter Erzähltechnik und an sich spannendem Thema – 18 jähriger Schüler verliebt sich in 30- jährige Englisch – Lehrerin – gelingt es Lenz in seiner Novelle nicht , den Figuren genügend Tiefgang zu geben. Ganz im Gegensatz zum Protagonisten Christian, der als Steinfischersohn tief auf den Grund der Ostsee tauchen muss. Nein, Lenz verharrt an der Oberfläche. Manche Dialoge wirken platt, vorhersehbar, hölzern. So was muss auch in den 60-iger Jahren nicht sein und hat nichts mit Lakonie der Erzählkunst zu tun, sondern ist schlicht tröge. Wetten, dass „Schweigeminute“ bald verfilmt wird ? Neben Traumschiff und Pilcher kann es sicher bestehen! Note: 4 (ün) <<
Anmerkung aus dem Jahre 2016: Es hat zwar etwas länger gedauert, aber acht Jahre nach Erscheinen der Novelle gab es nun tatsächlich eine Verfilmung des Stoffes für das Fernsehen. Selten kann man es behaupten, aber hier war es so: Der Film ist besser als das Buch! Weit über dem sonstigen TV- Niveau. (Trotz Edelkitschverdacht am Ende). Vor allem die beiden Hauptdarsteller sind glänzend besetzt.
>>Vom Schweigen zum Heilschweigen. ‚Schweigeminute’ wird von der gesamten literarischen Kritik einhellig gelobt. Fast überschlägt sie sich: “Wir haben meinem Freund Siegfried Lenz für ein poetisches Buch zu danken“, schreibt zum Beispiel der Vater aller literarischen Quartette. Die zweite Auflage lief schon durch die Druckmaschinen, bevor das Buch auf dem Markt war, meldet der Spiegel (19/2008). „Die `Schweigeminute`, eine zeitlose Kostbarkeit, sie passt in diese Zeit, resümiert Ulrich Greiner in der ZEIT (08.05.08).In diese unsere Zeit, in der, wie von unsichtbarer Hand gelenkt, Bestseller entstehen oder auch nicht. All dies Lob steigert die Erwartungen des Lesers, übersteigert sie sogar vielleicht.
Der Inhalt de Novelle ist allerorts nachzulesen. Deshalb beschränke ich mich auf ein paar Anmerkungen, die obiges Lob etwas in Frage stellen. Manche Details bleiben rätselhaft, wie zum Beispiel die Oxford-Stipendien, die Direktor Block (nomen est omen?) explizit in seiner Trauerrede erwähnt (S.9). Wozu eigentlich?„Hat es keinen anderen Ausweg für dich gegeben?“ fragt Kollege Kugler während der Trauerfeier (S.19). Da wird etwas Gravierendes angedeutet, das später nicht mehr aufgenommen oder ausgeführt wird.
Lesen Sie bitte Sätze des Schülers Christian laut: „Lob und Herrlichkeit, ich nenne die Namen und ergebe mich, Glorie sei Dir. Und dann dies Amen, das unser Orchester echohaft aufnahm, das leiser wurde und das sich wunderbar verlor an ein Universum des Trostes, überwunden der Actus Tragicus.“ Und dann stellen Sie sich einen Gymnasiasten vor, egal ob von heute oder von der Penne anno 1956. Was fällt Ihnen auf? Heilige Stella, ora pro nobis, warum auch nicht. Oder wenn die Lehrerin in Stella durchbricht und sie zur Oberlehrerin wird. Da klingen ihre Sätze gedrechselt wie ein Erwartungshorizont zur Animals Farm. Dabei ist sie allein mit Christian und spricht mit ihm über Mängel seiner Interpretation. Auch dieses Buch bildet. Der Südländer erfährt allerlei über Bräuche, Kleidung und Wortschatz an der Ostsee. Wer hätte auch geahnt, dass Steine gefischt werden?
Was hat mir gefallen? Beeindruckend, wie geschickt Lenz immer wieder die Perspektive wechselt „Sie trat ans Fenster, als suchtest du etwas“. Immer wieder gelingen dem Erzähler wunderbare Sätze, wenn er in Abwandlung eines Nietzsche-Zitates („Denn alle Lust will Ewigkeit“) bescheidener von der „Sehnsucht nach Dauer“ oder den Zusammenhang zwischen Schweigen und Glück andeutet: „Ich begriff, dass ich diese Entdeckung nicht in der Schule preisgeben durfte, einfach, weil mit einer Preisgabe etwas aufzuhören drohte, das mir alles bedeutete – vielleicht muss ja im Schweigen ruhen und bewahrt werden, was uns glücklich macht“. (S.126) Ein Ja zum Heil-Schweigen.
Note: 3+ ( ax)<<



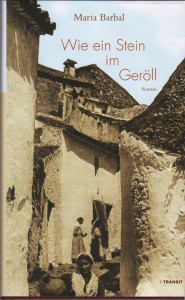


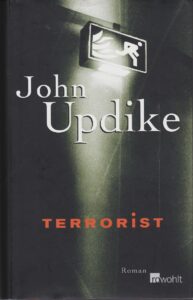 Rowohlt 2006 | 397 Seiten.
Rowohlt 2006 | 397 Seiten. Luchterhand 2005 – 331 Seiten
Luchterhand 2005 – 331 Seiten