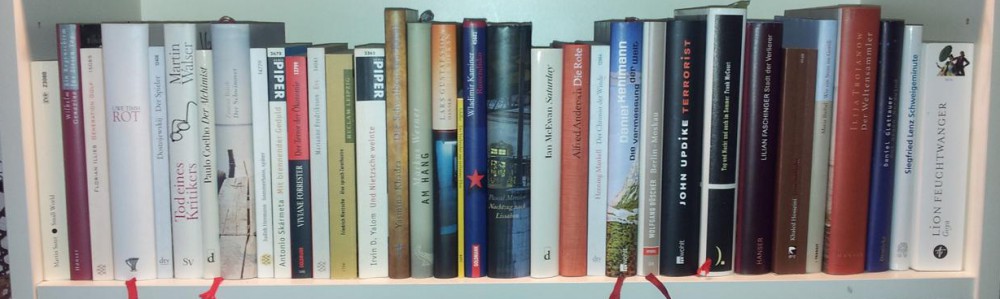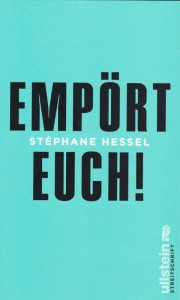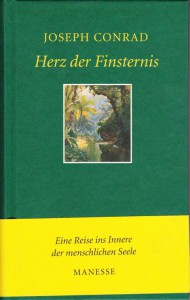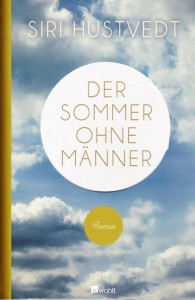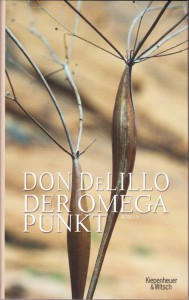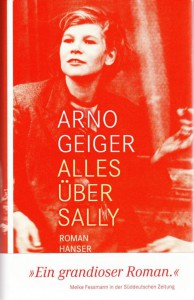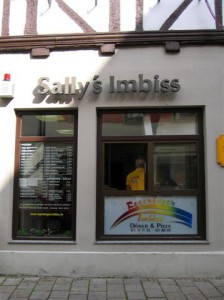>> In Zeiten des abnehmenden Lichts: „Roman einer Familie für euch“. Für uns also. Mehrmals taucht der Liedtext von Jorge Negrete auf:„México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan aquí.“ Leitmotivisch klingt hier schon am Anfang der Tod und die Sehnsucht nach Rückkehr an. Es geht um den Tod einer Ideologie und um das langsame Verschwinden einer Familie über mehrere Generationen. Eugen Ruge hat viel in seinen Roman gepackt. Den realen Sozialismus und seine bürokratischen Erstarrungen, Historisches, psycho-logische Verhaltensmuster, innerfamiliäre Verkehrs-formen und eine ganze Menge Komik. Manchmal schimmert ein bisschen Grass durch (Weihnachtsessen). Dem Autor wurde vorgeworfen, der Roman sei konventionell erzählt. Ich war froh darüber. Ein Vergleich mit „Der Turm“ (Uwe Tellkamp) und „Ein Kapitel aus meinem Leben“ (Barbara Honigmann) könnte interessant werden. Insgesamt eine überaus lohnende und interessante Lektüre. Note: 1/2 (ax) <<
>> Welch symbolische Botschaft: als am Ende von Wilhelms 90. Geburtstag am 1. Oktober 89 der mit den Resten des Büffet beladene Ausziehtisch zusammenbricht, geht neben einem Stück Familiengeschichte der Powileits auch die politische Geschichte der DDR zu Ende. Der Sargnagel des Systems, Inkompetenz und Verblendung, er findet seine groteske Parallele im Nagelmurks, mit dem Wilhelm dem Ausziehtisch letzten Halt zu geben versucht. Wilhelms Geburtstag, in 6 Kapiteln aus der Perspektive von 6 Familienmitgliedern erzählt, bildet den Kern des Romans, Episoden der Romanfiguren aus der Zeit von 1952 bis 2001 unterbrechen die Geburtstagsschilderung. Eine Viergenerationenfamilie, der es im DDR-Mikrokosmos Neuendorf vor allem an einem fehlt, an Offenheit und Empathie. Das Geburtstagsfest ist nur noch Fassade, die Familie längst in Auflösung begriffen. Wilhelm , ein zum Wohnbezirkssekretär miniaturisierter Stalinist, immer noch ordensdekoriert, ewiggestrig und senil, sieht die eigene Kinder- und Enkelgeneration mit Ausnahme von Irina (Russenbonus) als „Defätistenfamilie“, das Gulagschicksal seines Stiefsohnes Kurt wird verhöhnt („soll froh sein, dass er im Lager war und nicht im Krieg“), Charlotte Powileit, jetzt 86 und 62 Jahre Parteimitglied bilanziert die Ehe mit Wilhelm als Martyrium, die Aminophillin-Tröpfchen eine angedeutete letzte Rache. Kurts Ehe nach 10 Jahren Lagerhaft und 5 Jahren Verbannung 1956 mit seiner russischen Ehefrau Irina ins familiale Neuendorf zurückgekehrt – 1989 ein Scherbenhaufen: Irina, in der DDR nie wirklich angekommen, alkoholkrank (sie erscheint gar nicht beim Geburtstagsfest), die weihnachtliche Klostergans (glänzend!)als letztes verbliebenes Ritual zelebrierend, die Dauerbaustelle des Hauses ein Spiegelbild ihrer Seele. Alexander, der gemeinsame Sohn, schon früh den Eltern wie dem System entfremdet , flieht am Tag des Geburtstags in den Westen (Melittas Warnung an Markus gegenüber Oma u. Opa: „Nichts über Ungarn“). Kurt selbst ist an Wilhelms Geburtstag beim Anblick Melittas stärker mit „der Opposition in seiner Hose“ als mit den Lobpreisungen des heldenhaften Kampfes Wilhelms im Berliner Rotfrontkämpferbundes beschäftigt. Für den Vertreter der 4. Generation, Markus, den Sohn aus der Beziehung Alexanders mit Melittas, ist Wilhelms Geburtstag eine „Saurierparty“. Auch die Geschichte Iwanowas, Irinas 1976 aus Rußland nach Neuendorf übersiedelte Mutter, von Charlotte als „letzten Dreck“ behandelt, ein bizarres Migrationsschicksal in Selbstisolation, scheint mit Wilhelms Geburtstag einen Abschluss zu finden. Ein letztes Mal das immer wiederkehrende Gurkenglasgeschenk bevor der Erzähler die Rückkehr in die Heimatstadt Slawa andeutet.
Neben Wilhelm übernimmt Alexander als Vertreter der 3. Generation eine zentrale Rolle in Ruge Roman. Eine Krebsdiagnose 2001 bildet den Ausgangspunkt zur Flucht nach Mexiko, wo er -Kindheitserinnerungen an das mexikan. Exil seiner Großeltern folgend -, auf Spurensuche geht. Das einleitende Romankapitel mit dem letzten Besuch beim demenzkranken pflegebedürftigen Vater Kurt in Neuendorf und der auch symbolisch zu deutenden Verbrennung persönlicher Erinnerungsstücke des Vaters (allein ein „Schachbrett der Großeltern mit Persönlichem“ begleitet) bereitet Mexiko vor, vier weitere Kapitel (sie sind nicht die stärksten des Romans) , in denen wir Alexander vor allem auf der Suche nach sich selbst sehen, einer Suche, die eigentlich schon früh mit der Abkehr des Rebellierenden gegen den „Scheißsozialismus“ in der DDR begann. Protest gegen NVA-Dienst, Abbruch des Studiums, Hausbesetzung in Ostberlin, Bruch mit dem Vater, Beziehungschaos (Christina, Melitta,Catrin,Marion), Bruch mit dem eigenen Sohn Markus, kurz vor der Wende Flucht nach Gießen, Theaterarbeit in Moers, Krebsdiagnose. Im Futur lässt uns der Erzähler ahnen, dass Alexanders Schachpartie mit der Zufallsbekanntschaft des Motorradrockers Xaver an der mexikanischen Küste seine letzte sein wird.
Eine beeindruckendes Dokument des Zerfalls einer Familien- wie politischen Geschichte. Muffigkeit, Kleinbürgerlichkeit, aber auch Kontinuitäten des Terrors (das Schweinsgesicht des Genossen Ernst im Schauprozess Moskau 1941 wie 1966 beim Prozess gegen einen Genossen namens Rohde), Seilschaften, Männerbündisches, der Verlust zwischenmenschlicher Beziehungen, Entfremdung, Lügen. Besser als jedes Geschichtsbuch, dieser Einblick in den real existierenden Sozialismus und seine Opfer. Ein glänzender Erzähler, dessen Figuren auch sprachlich authentisch wirken.
Note: 1– (ai)<<
>> Raffiniert angelegte und höchst amüsant erzählte deutsch-deutsche Geschichte.
Note 1/2 (ün)<<
>>Eingebettet in den Durchbruch der Berliner Mauer, den Umbruch beider deutschen Länder und den Aufbruch verwandtschaftlicher Beziehungen schafft Ruge eine zeitgenössische Buddenbrock Saga. Vier Generationen einer deutschen Sippe mit den Wurzeln im ausklingenden Kaiserreich polarisieren sich in der Weimarer Republik, integrieren sich in den real existierenden Sozialismus der deutschen demokratischen Republik und flüchten sich letztendlich in die konsumverwirrte Bundesrepublik. Interessant verschachtelt folgen die Kapitel drei Hauptachsen. In einer chronologischen Folge fällt das Schlaglicht auf die kommunistischen Großeltern Wilhelm und Charlotte, die Regime-angepassten Eltern Kurt und Irina, den zweifelnden Sohn Alexander (Sascha) sowie das rotzbubige Enkel-Ekel Markus. Eine zweite Kapitelreihe sammelt über wenige Tage hinweg die letzten Eindrücke des auf den Spuren der Großmutter irrenden, todkranken Alexander in Mexiko. In der dritten Erzähllinie lassen eingestreute Kapitel die Geburtstagsfeier des 90jährigen Opa Wilhelm sechsmal aus der wechselnden Sicht der verschiedenen Generationen aufleuchten. Ein gelungenes Stück Literatur mit deutsch-deutschen Aspekten als tiefschürfendes wie auch situationskomisches Familienepos.
Charlotte und Wilhelm werden für viele Jahre von der DDR zur Auslandsagitation nach Mexiko entsandt, um dort eine Kampagnenzeitung herauszugeben. Trotz jahrelanger Bitten wird den beiden die Rückkehr verwehrt. Stattdessen entmachtet sich die kleine Redaktion durch große Grabenkämpfe selbst. Schließlich kommt doch der Marschbefehl, die Heimreise anzutreten um die Leitung eines Ausbildungsinstitutes für Diplomaten zu übernehmen. Was bleibt, sind Charlottes Führungsansprüche. Was nicht bleibt, sind Wilhelms Beiträge. Lange Zeit kann er den Anschein erwecken, alles bewegen zu können und jeder nimmt ihm irrigerweise ab Fidel Castro zu kennen, nur weil er Havanna Zigarren pafft. Doch dieser trübe Nebel lichtet sich, Wilhelm wird als Nichtsnutz entblößt und provoziert seine Entlassung. Letztendlich schließt sich der Kreis wieder: Charlotte bleibt in Grabenkämpfe verstrickt und Wilhelm belebt seine Umwelt mit Anekdoten.
In der nächsten Generation tritt Kurt in die Fußstapfen seiner ambitionierten Mutter. Er wird nach politischen Zwischenbestrafungen mit 10 Jahren Arbeitslager wegen Kritik an Stalin letztlich doch als DDR Historiker rehabilitiert, der bei der peniblen Ausarbeitung seines epochalen Gesamtwerks die Familie terrorisiert. Trotz seiner Systemtreue wird Kurt von Wilhelm verachtet, da er „nur“ im Arbeitslager war statt dem sozialistischen Vaterland im Krieg gedient zu haben wie seine beschämend schöne Gattin Irina. Im DDR Alltag verschlingt Irinas zielsicherer Sinn für das Edle ein Vermögen. Dieser Sinn vermag jedoch nicht das Hässliche ihres Charakters zu verbergen. Unausstehlich lässt sie sich gehen, erniedrigt quälend ihre alte Mutter und begegnet Kurt voller Unmut, wie dieser überangepasst seiner Mutter folgt.
Kurts Sohn Alexander ist der Charakter der inneren und äußeren Immigration. Er macht mit der Wende in den Westen rüber und kehrt nach 12 Jahren zurück, hat Jobs verloren und Schulden zurückgezahlt, Filmprojekte angeregt und Theaterstücke geschrieben, ist Bindungen eingegangen und einsam geworden. Hat eine klassisch ideale Bindung an seine Oma, die heimlich mit ihm nicht nur marmeladenveredelte Schnurpsbrote teilt. Die Oma, ein durch und durch Wert tragender Mensch in seinem kleinen Dasein. Als er viel später an Blutkrebs erkrankt und nicht nur die Gesundheit sondern auch seine Bezugspunkte verliert, sind es die Spuren der Oma in Mexiko die ihm eine vage Richtung geben. Er irrt umher, wird ausgeraubt und hintergangen wie ein unwissendes bockiges Kind in einer beängstigenden Erwachsenenwelt und flüchtet schließlich in den Halbschatten einer Hazienda von Alt-Achtundsechzigern, wo die Welt wieder klein und überschaubar scheint. Er ist derjenige, der immer unbestimmte Zweifel in sich trägt, meist ungerichtet, manchmal auf der Suche nach Integrität. So bricht er als junger Mann sein Geschichtsstudium ab um nicht mehr lügen zu müssen. Willkürlich empfundene historische Umdeutungen werden für ihn gerade in den wechselvollen Zeiten deutscher Taten und Untaten unerträglich.
Der letzte in dem Kreis ist der größer werdende kleine Markus, Sohn aus erster Ehe von Sascha. Kiffer, Wichser, no-bock-Penner, Nörgler, Angeödeter vom Gesabber der Friedensbewegten, kleiner Neonazi mit alles voll die Kotze und zugedröhnt mit Ecstasy, wenn es sich ergibt. Orientierungslos geworden – vielleicht durch den Vaterverlust, vielleicht auch durch den Vaterlandsverlust, den er nicht erkennt, dessen Ausmaße aber das deutsch-demokratische Volk erfasst, welches im politischen Tsunami der Ostüberflutung durch den Westen mitunter zu ertrinken droht.
So oder so bleiben die Zeiten, durch die sich die vier Generationen bewegen, denkwürdig. Am Anfang die streng geordneten politischen Bahnen mit dem Preis der Selbstaufgabe und institutionalisierter Fremdbestimmung, fehlerhafter politischer Freiheit und kleinkariertem Kontrollverlust. Am Ende die Umkehrung mit Freiheit im Äußeren, Einbuße von Werten und Ich-Aufgabe. Und dennoch ist nicht alles Schwarz-Weiß. Ruge zeigt es uns: auch Geburtstagsrituale können umso amüsanter sein, je öfter ihre Absurdität zelebriert wird. Ein intelligentes Gegenwartswerk in einem neuen Erzählrahmen.
Note: 2+ (ur)<<