
Hanser Berlin2022 | 287 Seiten
>> Eine außergewöhnliche Milieustudie im Mikrokosmos Berlin Neukölln. Eine Pflichtlektüre nicht nur für Integrationsbeauftragte. Die zentralen Akteure alle schon sehr früh geprägt durch Gewalt, Krieg und Flucht. Dass damit alle „ihre Traumata in sich trugen“, erklärt wie dünn das Eis ist abzugleiten in eine Welt, die ihre eigenen Spielregeln und Moralvorstellungen definiert. Zu verlockend die Verführungen der libanesischen Gang um Marwan und Heydar um dem vor Schah- und Mullahterror geflohenen iranischen Familienvater Jamshid vor allem seinen Sohn Saam zu entfremden. Hält noch der 8jährige der Familienehre stand (wir sind keine Diener) und zwingt seinen kleineren Bruder Nima Frau Winkler die Belohnungsmünze zurückzugeben, so brechen in dem Maße alle Dämme, in dem die Peergroup durch Gangsterraprituale und Markenartikel neue Standards setzt. „Drei Steifen Adidas zwei Streifen Caritas“ so schlicht das Klassenmodell, da ist das auf die C&A Jacke aufgenähte Lacoste Krokodil nur ein kurzes Übergangsstadium in Saams Abwärtsbiographie. Klassenkamerad Heydar wird zum Drahtzieher dieser Entwicklung, sein Rekrutierungsfeld speist sich eigentlich aus Loosern, die er dem Schultheisskneipenmilieu in der „Weißen Rose“ zuführt. Dass an diesem Ort selbst ein Tischkickerspiel gefährliches Machtverschiebungspotential in sich birgt, dass sich hier Dummheit und Macht ein Stelldichein geben, dass sich hier die Einschätzung von Saams Vater Jamshid von der „stupiden Hierarchie von Totgeburten“ offenbart, all dies spürt Saam ohne daraus jedoch Konsequenzen ziehen zu können. Dass gerade an dieser Stelle des Romans der Autor für einen kurzen Moment vom Erzähler zum gesellschaftskritischen Kommentator wird und die Verantwortlichkeit des liberalen Rechtsstaats benennt, ist bemerkenswert. Vom „Ritterschlag“ durch Ali Pacino über das Verticken von Iceberg-Pullovern oder Scarface-Kopien, über Heydars Rolex „Bruder“geschenk führt Sams Weg geradlinig dorthin wo das Gesetz der Gewalt gilt. Erst „der Sound, wenn Fleisch auf Fleisch trifft“, der Schlagring gegen den Zigeuner, macht in dieser arabisch dominierten Gegenwelt das Kind zum Mann. Mit dem Abstieg in die Kriminalität beginnt der Aufstieg im Milieu, in dessen Sprache sich die Handlungsoptionen ausschließlich zwischen „ficken“ und „gefickt werden“ bewegen. Letzteres verlangt in deren Logik nach Rache. Wie die aussieht, erzählt die Geschichte des kriminellen Palästinenserjungen Jamal. Demütigung von Saams Bruder Nima durch den Klau seines BMX-Rädchens, Saam macht im Auftrag des Clanchefs Marwin Jamal zum „Frankenstein von Neukölln“ („wegmachen“ lautet die Parole!)) . Erneuter Showdown der beiden Täter während Saams 6jähriger Knastepisode. Am Ende von Khanis Roman steht der von Jamal beauftragte Mord an Saam durch einen 15Jährigen. Die Fortsetzung einer Geschichte von Gewalt und Gegengewalt ist absehbar.
Die Entwicklung der Biographie des jüngeren Bruders Nima spielt in einer anderen Liga und ist eher eine Nebenhandlung, hätte aber durchaus das Potential einer eigenen Neuköln-Geschichte. Nicht die „Weiße Rose“ sondern der Yard für Skater und Daves Friseursalon bilden neben der reichlich hippen Familien-Maybach Episode (der Name ist Programm) die Kulisse. Das Heroinmilieu scheint gediegener, weniger gewalttätig und doch hätte der Leser vom Insider Khani gerne etwas mehr darüber zu erfahren, ob in Nimas Gymnasialklasse, deren Zusammensetzung (großartigeTypologie S.147) so wenig der „Urbevölkerung“ deutscher Bildungslandschaft entspricht, auf dem Weg zum Abitur auch Ansätze von Wissen und „soft-skills“ vermittelt wurden, die zukünftig Neukölln zu weniger Südlibanon machen.
Wo bleibt das Positive? Der Autor Khani ist die Erfolgsgeschichte. Mögen auch Hund, Wolf, Schakal Assoziationen offenbleiben, dieser Roman ist brillant und dies vor allem in der virtuosen Beherrschung unterschiedlichster Sprachniveaus. Fast jede Seite ein Beleg. Note: 1 – (ai) <<
>> Das richtige Buch zur Silvester Nacht in Berlin! Wer wissen will, wie die Jungs in Neukölln ticken, sollte unbedingt dieses Buch lesen. Spannend, witzig und mit großer sprachlicher Kühnheit führt uns Khani ein in die Kultur der in Berlin gestrandeten Einwanderer aus dem vorderen und hinteren Orient. Saam und sein Bruder Nima sind mit ihrem Vater Jamshid aus dem Iran geflohen. (Jamshid sieht sich allerdings nicht als Flüchtling, er befindet sich „auf einer Reise“ ). Schnell gerät Saam in Kontakt mit Jungs eines kriminellen Clans aus dem Libanon. Obwohl er ihre Dummheit sieht, sieht er auch ihre Macht. Und die fasziniert ihn. Saam findet schnell heraus, dass sich in dem Milieu Hierarchien leicht verschieben lassen, „die auf nichts beruhen als darauf, dass das Justizsystem des Landes eine Milde walten ließ, die sie als Schwäche fehlinterpretierten“ (S.60) Khani will der in „Watte gepackten Mehrheitsbevölkerung“ mit seinem Buch einen Spiegel vorhalten. Sehr gelungen und sprachlich ein Genuss. Note: 1 – (ün) <<
>> In seinem Debutroman bricht der persischdeutsche Autor den Verhau eines stockdunkln Kellerverlieses auf mit Blick in die tiefböse Unterwelt von Berlin-Neukölln. Migrationsschicksal, Schulabbruch, Familienentfremdung, Gruppendynamik, Kleinkriminalität, Drogenwirtschaft, Mord, Gefängnis. Von A bis Z das Alphabet des Niedergangs vorbei am deutschen Rechtsbewusstsein. B.K.Khani öffnet mit dem Gang durch das Milieugebäude aber auch einen Dachverschlag, in dem die Seelenzustände seiner Opfertäter von erhellendem Licht beleuchtet werden. Was sind die Beweggründe, was Entwicklungsstrudel, was Lebensengpässe? Die Triebkräfte sind Ich-Überhöhung, Erniedrigung, Gewaltlust, Machtzeremonien, Respektperversion. Der ganze Mist. Das Werk von B.K.Khani ist jedoch kein Sachreport sondern ein literarisches Meisterwerk, das auf eine erstaunliche Weise Emotionalität und Erkenntnis so miteinander paart, dass das Entsetzen eingehegt und das Wissen in anspruchsvolle Prosa gekleidet wird. Grandios.
Im Mittelpunkt steht die Familie Homayoon. In Persien der 70er Jahre lernt der Student Yamshid im sozialistischen Schulterschluss gegen das amtierende Schah-Regime die Kommilitonin kennen, die er später heiraten wird. Zwei Söhne werden sie haben. Die Mutter wird früh von den Kindern getrennt. Ermordet von dem nachfolgenden Ayatollah Regime, das auch den agitierenden Vater zum Krüppel schießt. Er flüchtet mit den Buben nach Deutschland, dem Achtungland. Achtung Bosch. Achtung Benz. Achtung Beckenbauer. Das Land disziplinierter Erfolgsgeschichten. Der Vater wird Taxifahrer, aber ohne Erfolge und nie heimisch in der kapitalistischen Fremde. Komfort wäre ohnehin Verrat an marxistischen Idealen. Laut Yamshid stehen auch die aufkeimenden Depressionen und psychosomatischen Tics seiner schulpflichtigen Söhne in dieser Wohlstandsgesellschaft den beiden nicht zu, solange in Teheran Kinder Schlachthofmüll nach Essbarem durchwühlen müssen.
Die Nicht-Heimat heißt jetzt Berlin, Ghetto-Berlin. Eingepferchte Nationalitäten. Die Perser bringen historischen Stolz mit, den sie bei Arabern nicht erkennen können. Als Perser sind sie Verlierer mit erhobenem Haupt. Araber sind Verlorene. Die Ursprungsdeutschen dagegen sind bemüht: die hilfsbereite Nachbarin, die einfühlsame Lehrerin, die toleranten Schwiegereltern in spe. Die Behörden haben Luft nach oben. Der deutsche Richter überzeugt durch Fairness. Für die beiden Söhne wird jedoch im Laufe der Zeit die Clique zwingend. Dem Vater entgleiten die Söhne. Das Milieu garantiert, vom Sumpf verschluckt zu werden. Und so kommt es auch.
Saam ist bei der Einreise 1988 neun Jahre alt, sein Bruder Nima erst vier. Als Nima der Nachbarin die Tasche trägt und spontan einen Obolus erhält, zwingt der Größere den unbedarften Kleinen das Geld zurückzugeben – Perser seien keine käuflichen Diener. Saam, der Hauptprotagonist des Buches, gerät schnell in die Einflusssphäre des libanesischen Jungen Heydar, der wie seine größeren Brüder schon früh mit beiden Beinen im kleinkriminellen Untergrund verwurzelt ist. Willkürlich gewählte Feindbilder, Schlägereien als Reifeprüfung, Knochenverstümmelungen durch Schlagringe, Narben durch Rasierklingenwaffen, eigene Verletzungen als stolz vorgeführte Premiumnoten. Der langsame Ein- und Abstieg scheint unumstößlichen Naturgesetzen zu folgen. Ein bissenthemmter Dobermann für Territorialansprüche wird rekrutiert. Überfälle auf Spätis zum Warmlaufen, Einsatz von Schusswaffen bis zum gescheiterten Überfall auf eine Apotheke. Der Apotheker im Kiez zieht überraschend als erster seine Waffe und verletzt Saam schwer. Man musste nur seiner Blutspur folgen, um ihn für Jahre hinter Gitter zu bringen. Sein Komplize Heydar kann entkommen und wird nicht verraten. Ehrensache. So bleibt die brüderliche Freundschaft des gewalttätigen Duos unsterblich.
Der kleinere Bruder Nima dagegen meidet die Gewaltarena und den zunehmend entfremdeten Bruder, findet Freude und Freunde beim unermüdlichen Skaten, macht Abitur und wird von high end girls umschwärmt. Die wohlhabende, urdeutsche Familie von Josephine empfängt ihn mit offenen Armen und organisiert schon bald einen Ausbildungsplatz. Nima macht sich prima. Doch im tiefsten Inneren spürt er einen Kulturriss. Josephine und alle Angebote hinter sich lassend, kehrt er ins Milieu zurück – nicht in den grenzen- und kulturlosen Rambokrieg, sondern in die stille Geborgenheit überschaubarer Kokaingeschäfte. Statt schwarzem Audi 8, geparkt in der zweiten Reihe, eine Mercedes A-Klasse mit Sylt-Aufkleber. Kleine Wohngemeinschaft in der Geld-gewaschenen Eigentumswohnung mit Fischgrätenparkett. Ein Dasein im Dauerauftragsmodus. Er will nicht mehr wollen. Ihm reicht der gediegene Frieden.
Saam verbringt derweil sechs Jahre hinter Gittern. Auch hier regiert und verfolgt das Kiezmilieu. Saam steht auf einigen Rechnungen. Schlägereien im Knast zwingen ihn in zweimonatige Isolationshaft, die ihn für immer belasten wird. Mentale Deprivation, Alpträume, Paranoia, kognitive Verluste. Eine Symptomatik, die sein nur noch kurzes Leben infiltriert, obwohl er sichtbare Besserung lebt, im Gefängnis eine Ausbildung als Koch abschließt und frühzeitig in den offenen Reha-Vollzug entlassen wird. Diese Situation nutzend wird sein Todesurteil vollstreckt, als ein 15-jähriger Nachwuchskiller ihn mit einem LKW überfährt und vollständigkeitshalber noch das Hirn aus dem Schädel schießt. Saam hatte vor Jahren einen Araber fürchterlich entstellt. Dieser hatte sein körperliches und mentales Gesicht verloren, nicht aber seine rächende Geduld. Damit endet die Geschichte. Der Sumpf währt ewiglich. Ein neuer Zyklus beginnt mit einer hochmotivierten Nachwuchsgeneration im deutschen Toleranzmorast.
Vor allem zwei Dinge machen dieses Buch der Rollentiere Hund Wolf Schakal so wertvoll. Da ist zum einen der von B.K.Khani unprätentiös vermittelte Erkenntnisgewinn in die Logik einer Gegenwelt, die grundlegende Werteprinzipien der Gesellschaft nicht im Geringsten teilt. Alles, aber auch wirklich alles, hat in dieser Männerwelt mit Machtverschiebung zu tun, selbst wenn es nur um Mikrometer geht. „Weil wir Löwen sind. Wir schleichen uns nicht heimlich an. Wir gehen da raus, fressen ihre Kinder und gucken ihnen dabei in die Augen. Das hat mit Stolz zu tun“ (Originalton Hydar). Und wenn einer Schwäche zeigt, disqualifiziert er sich als unwürdiger Aussätziger. Das Klima der Angst. Der Terror breitet sich im Kopf aus. Und weil jeder das meiden will, übernimmt er den Codex. Das Perpetuum mobile in nicht-enden-wollender Dynamik rotiert. Überlegene Aggression ist die Währung und davon sollte jeder genügend im Beutel haben.
Der Autor B.K.Khani spricht nur bedingt über die Wechselwirkung von Gesellschaft und Milieu. Und dennoch ist der Roman ein Spiegelbild der deutschen Naivität. Die praktizierte Toleranz wird als lächerliche Schwäche verstanden, die lasche Strafverfolgung als stimulierendes Katz-und-Maus Spiel. Schon für die halbstarken Kids sind es Beifang-Erfolge, wenn die begleitenden Sozialarbeiter in die Depression getrieben werden. Als die Sparkassen wegen anhaltender Überfälle das Bargeld abschaffen, wird das als Kapitulation vor den Gangs gefeiert. „Es gibt auch Gesetze nicht. Staat nicht. … Polizei nicht. Wenn sie überhaupt kommt, kommt sie irgendwann, und irgendwann gibt es nicht, es gibt nur jetzt. Und es gibt den Sound, wenn Fleisch auf Fleisch trifft. … Brechende Gesichter gibt es.“
Gerade wegen der brutalen Zeichnung dieser Welt, ist es umso überraschender, dass B.K.Khani dieses Bild mit beeindruckendem Sprachspiel skizziert. Das ist nichts anderes als hohe Literatur. Wenn z.B. die Flüchtlingskinder diese unbarmherzige, fremde Sprache lernen müssen: „Sie erfuhren zunächst von der Existenz, dann von der Dringlichkeit und schließlich von der Willkür deutscher Artikel. Dass es nicht die, sondern das Mädchen heißt und dass Geld und Waffe nicht männlich sind.“ Oder wenn sie die Lakritz von der mütterlichen Nachbarin nicht ablehnten, weil sie Lakritz für Schokolade hielten, lernten sie, „ dass Höflichkeit etwas sein konnte, das ungenießbar salzig schmeckte und nicht schmelzen wollte“. Das Buch ist reich an diesen empathischen Formulierungen. Großartig. Note: 1 (ur)<<
<< Alter, echt, ein cooles Buch. Da kann ein kleiner Pisser vom Neckar mal sehen, wie es im Späti in Berlin so zugeht. In Neukölln genauer. Will ja keinen Stress machen, aber in spätestens 50 Jahren sind wir hier vielleicht genau so weit. Geduld, Geduld. Jetzt erst mal einen Wodkashot, da schreibt’s sich’s leichter. Ich merke, dieser Besprechungsstil wird dem Buch doch nicht gerecht. Dafür ist der Roman zu komplex.
Er beginnt in Teheran auf einer Dachterrasse, wo der kleine Saam mit Insekten spielt (dies Faible wird ihn lebenslang begleiten) und zusehen muss, wie sein Vater Jamshid verhaftet wird. Die Verhaftung nimmt jedoch ein unerwartet gutes Ende, der Vater kann mit seinen Söhnen Saam und Nima ausreisen. Als Kommunist hatte Jamhid gegen den Schah gekämpft. Seine Frau war von den Mullah-Schergen getötet worden. Schweden, Sowjetunion, Jugoslawien, Deutschland stehen zur Auswahl. Es wird das „Achtungsland“ (S.29) Deutschland. Dabei ist Deutschland doch das Epizentrum des strukturellen und nicht strukturellen Rassismus… ? Im Süden hat sich das anscheinend immer noch nicht herumgesprochen. Und warum in Deutschland dann nach Neukölln und nicht nach Überlingen oder gar Tübingen?
Die Deutschen werden insgesamt irritierend positiv dargestellt. Frau Winkler, pensionierte Lehrerin, unterrichtet die beiden Jungs in Deutsch. Familie Maybach, eine alternativ bürgerliche Familie, zeigt sich sehr offen und gastfreundlich gegenüber Nima. Mit dem Richter, der Saam verurteilt, wäre Saam gerne befreundet. Und Gymnasiast Nima beklagt sich nie über schulische Diskriminierung. Andere kommen nicht so gut weg. „Klauten, logen und erpressten“ heißt es über die Araber, die Saam während seiner Zeit im Knast kennenlernt. „Die Türken waren etwas umgänglicher, aber auch selten interessant.“ Und dazu geistert auch noch das Unwort „Zigeuner“ durch den Text. Vielleicht erklärt es sich so, dass das Buch in Klagenfurt durchfiel?
Doch zurück nach Berlin. Saam gerät schnell in problematische Gesellschaft. Mit einem jungen Libanesen begeht er Überfälle. Beim zwölften Überfall schießt das Opfer zurück und verletzt Saam. Seinen Kumpanen und Verführer verrät er nicht. Vier Jahre Gefängnis mit alles. Auch Einzelhaft. Jamal, den er einmal verprügelt hatte, taucht im Gefängnis auf. Dessen Rache wird ihm nach der Entlassung zum Verhängnis werden.
Kriminalität hatte es leicht gemacht, Respekt, Status und Macht zu erlangen. Hier dominieren starre Weltbilder. Denken in Hierarchien. „Hierarchien (…) die auf nichts beruhten als darauf, dass das Justizsystem des Landes eine Milde walten ließ, die sie als Schwäche fehlinterpretierten.“ Justizkritik? Fürwahr kein leichtes Leben: “Immer mit oben und unten. Mit auslachen und ausgelacht werden, mit ficken und gefickt werden.“ Behzad Karim Khani gelingen viele verdichtete und gleichzeitig großartige Sätze.
Vater Jamshid schlägt sich als Taxifahrer durch. Er leidet, weil er sieht, wie sich seine Söhne entwickeln. Dabei bewahrt er seine Würde und wundert sich über mancherlei in Deutschland („Pflanzenabfallverordnung“). Die Sprache ist sehr facettenreich. Poetisch, wenn Insekten beschrieben werden, lakonisch unterkühlt beim Charakterisieren von Menschen, aber auch brutal. Die Vierbuchstabenwörter fehlen nicht.
Wie soll es weitergehen mit Deutschland, mit der Migration? Der Autor Behzad Karim Khani ist optimistisch und fordert, „dass man uns als die unumgängliche Notwendigkeit anerkennt, die wir hier darstellen. Davon, verstanden zu haben, das wir weder Nähr-noch Schadstoff in der Blutbahn dieses Landes sind, sondern das Blut selbst. Und davon, dass wir gar keine Zustimmung der Mehrheitsgesellschaft brauchen, die es ohnehin in anderthalb bis zwei Generationen nicht mehr geben wird. Da kann sich die politische Mitte, die Rechte noch so aufregen, drohen und irre Parteien wählen. Mehr als einen Ausdruck ihrer zunehmenden Irrelevanz bekommt sie nicht hin.“ (wochentaz vom 18.-24. Februar 2023). Na denn, schau mer mol. Note ( 1/2) (ax) <<
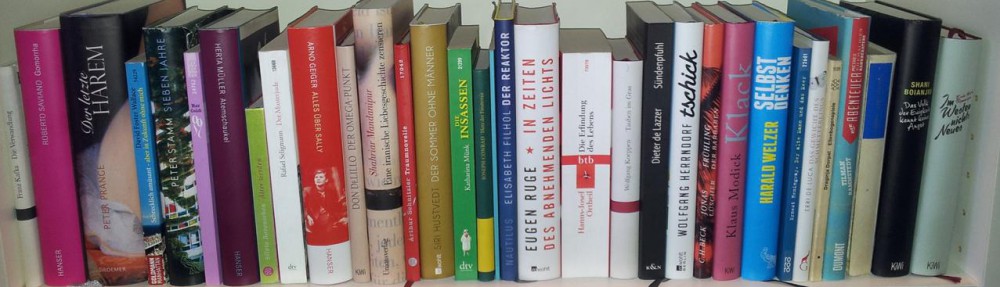
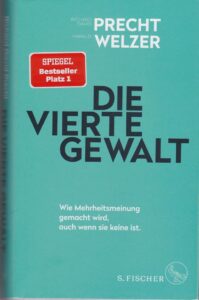 S. Fischer Verlag 288 Seiten
S. Fischer Verlag 288 Seiten Berlin Verlag 240 Seiten
Berlin Verlag 240 Seiten Rowohlt 2021 – 302 Seiten
Rowohlt 2021 – 302 Seiten Edition Suhrkamp SV 2017 – 144 Seiten
Edition Suhrkamp SV 2017 – 144 Seiten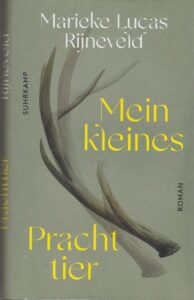 Suhrkamp 2021| 364Seiten.
Suhrkamp 2021| 364Seiten.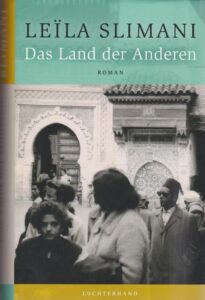 Luchterhand 2021 – 379 S.
Luchterhand 2021 – 379 S.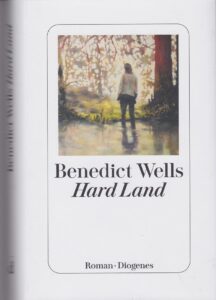
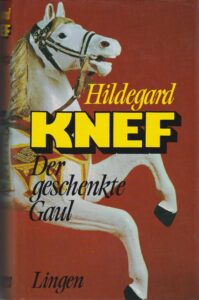 Lingen Verlag 1970 – 364 Seiten
Lingen Verlag 1970 – 364 Seiten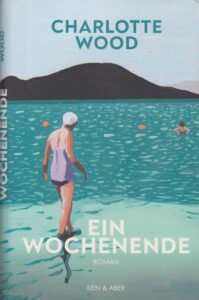 Kein & Aber 2020 | 284 Seiten.
Kein & Aber 2020 | 284 Seiten.