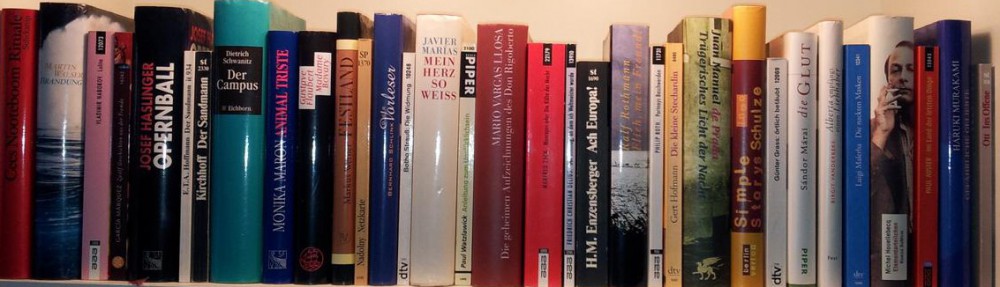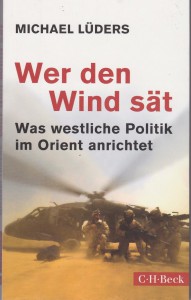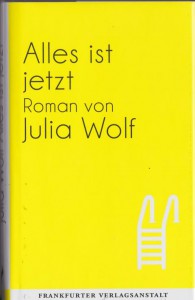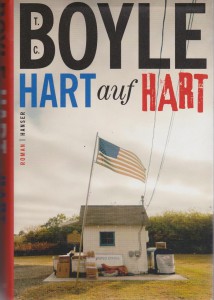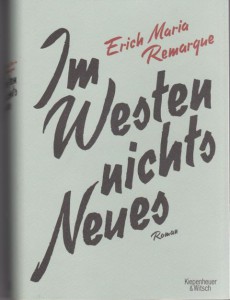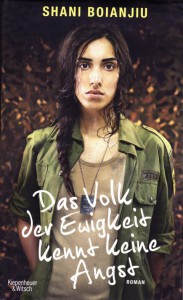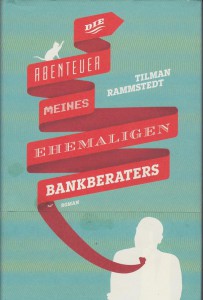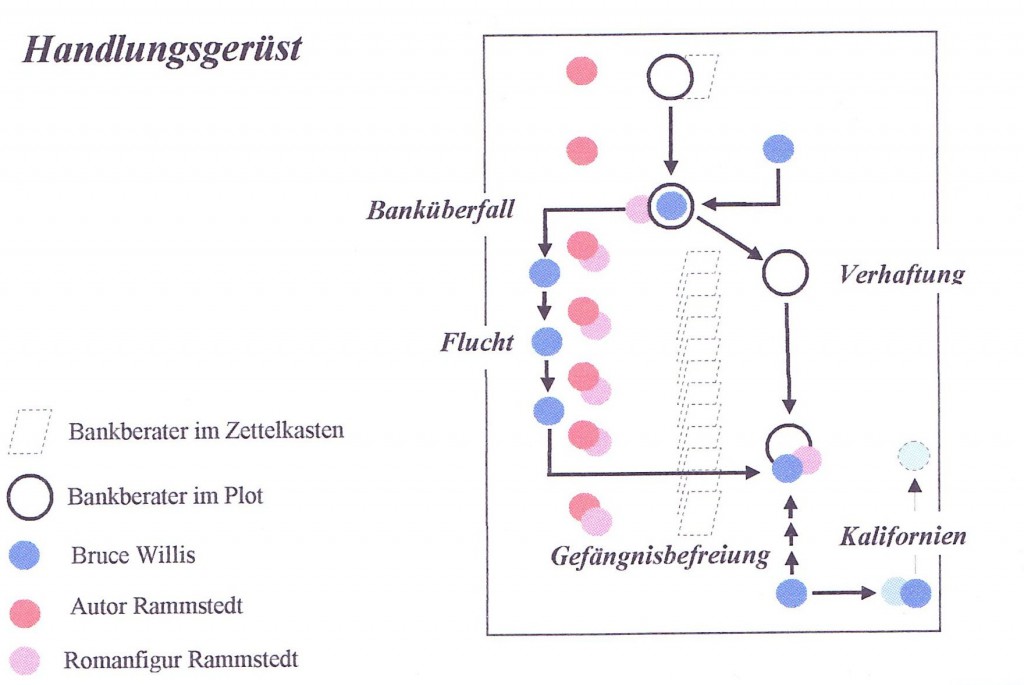>> Lüders beschreibt vor allem die Aussenpolitik der Vereinigten Staaten im Nahen und Mittleren Osten nach dem 2. Weltkrieg. Dabei ist seine Bilanz ernüchternd und erschreckend zugleich. Vom Putsch im Iran, dem Sturz des frei gewählten Premierministers Mossadegh 1953 durch den CIA über die militärischen Interventionen in Somalia, Afghanistan, im Irak, in Syrien und in Libyen (letzeres in Form „delegierter Kriege“ vor allem durch Großbritannien und Frankreich) bleibt ein Scherbenhaufen. Staaten zerfallen, Terrororganisationen wie Al-Qaida und der Islamische Staat entstehen, daneben auch marodierende Banden, die Zivilbevölkerung ist das eigentliche Opfer, Millionen Flüchtlinge verlassen ihre Heimat. Das Grundmuster interventionistischer Politik ist immer dasselbe: Dämonisierung des Gegners, Gut-Böse Klischees, vermeintlich ethische Motive im Namen von Demokratie und Menschenrechte, wo es um knallharte machtpolitische und ökonomische Interessen geht. Wirtschaftsanktionen, auch sie betreffen vor allem die Bevölkerung, gehen als Knebelinstrument der Entscheidung für militärische Mittel voraus. Der militärischen Strategie scheint keinerlei Perspektive einer neuen staatlichen Ordnung zu folgen. Unter Missachtung historischer Entwicklung religiöser und politischer Gegebenheiten (innerislamische Konflikte Sunniten/Schiiten, Feudalstaatlichkeit, Clan- und Stammesstrukturen, Klientilismus etc.) bestimmen angloamerikanische Denkmuster das politische Handeln. Wo, so möchte man auch Lüders fragen, sind angesichts solcher Naivität der politischen Eliten die intellektuellen Eliten der Islamwissenschaft, der Kenner der arabischen Welt? Oder ist das Oval Office allein das Vorzimmer der Rüstungs- und Erdölindustrie, den einzigen Gewinnern des amerikanischen Interventionismus. Neben der im wörtlichen Sinne verheerenden Rolle der USA und z.T. ihrer westlichen Verbündeten wird in Lüders Analyse das innerstaatliche Konfliktpotentiale des arabischen Raumes eher am Rande erwähnt. Rückständigkeit, vorwiegend ländliche Strukturen, Fehlen städtischer Mittelschichten, religiöser Fanatismus, Missachtung von Menschenrechten, korrupte Eliten, keine legitimierten Institutionen – die notwendige Basis für Demokratie und Rechtsstaatlichkeit im westlichen Sinne fehlt. Hinzu kommt, dass durch Erdöl reich gewordene Staaten wie Saudi-Arabien und die Golfstaaten ein doppeltes Spiel spielen, das allerdings durch gigantische Rüstungsexporte vor allem aus den USA befeuert wird. Auch die kompromisslose Politik Israels gegenüber den Palästinensern, die Verweigerung einer Staatenlösung, die völkerrechtswidrige Besatzungs- und Siedlungspolitik, die Brutalität der Gazakriege und die Zerstörung der Lebensgrundlage der dortigen Bevölkerung, vom Westen fast widerspruchslos geduldet, steht jeder Befriedungsperspektive im Nahen Osten im Wege. Lüders Analyse von mehr als 50 Jahre amerikanische Interventionspolitik und ihrer Folgen im vorwiegend arabischen Raum ist dringend notwendig, zumal in solch verständlicher Form. Sein Urteil schonungslos, vielleicht zuweilen auch provokativ. Was fehlt ist die Frage: Welche Alternativen bieten sich an? Gibt es zwischen Raushalten und militärischem Eingreifen noch einen dritten Weg? Für die Zivilbevölkerung ist er überlebensnotwendig. Note: 1/2 (ai) >>
>> „Was westliche Politik im Orient anrichtet“ ist das Thema des Buches, das der ZEIT-Korrespondent Michael Lüders geschrieben hat. Rund 60 Jahre blickt er zurück. Der „Sündenfall“ beginnt mit dem gewaltsamen Sturz des demokratisch gewählten iranischen Premierministers Mossadegh durch CIA und britischen Geheimdienst. Alles was später im Iran passieren wird, lässt sich hieraus ableiten. Die fatalen Interventionen im Nahen und Mittleren Osten zeitigen schlimme Folgen. Im Schlusskapitel kritisiert der Autor das Kritiktabu am Staat Israel. Ein Stichwortverzeichnis und eine Liste der verwendeten Abkürzungen hätten die Lektüre erleichtert. Auf der letzten Seite schlägt Lüders vor, die Schreibtischtäter George W. Bush, Dick Cheney, Tony Blair und Donald Rumsfeld vor den Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag zu stellen. Dies wird eher ein frommer Wunsch bleiben. Leider. Ein gut zu lesendes Buch, das klüger macht.
Note: 1/2 (ax)<<
>> Vieles von dem, was Michael Lüders in diesem wichtigen Beitrag zur aktuellen Lage in Nahost schreibt, ist dem kritischen Beobachter des Zeitgeschehens wohl durchaus bekannt, vielleicht aber nicht mehr voll im Bewusstsein gewesen. Das ist das große Verdienst Lüders: Die komplexen Zusammenhänge historisch nochmals aufzuzeigen. Angefangen vom Sturz der gewählten Regierung Irans durch den CIA im Jahre 1953, die anfängliche Unterstützung der Taliban und Osama bin Ladens in Afghanistan und Sadam Husseins im Irak durch die USA , das spätere Embargo Iraks durch die USA , das Millionen Opfer gefordert hat, bis hin zu den plumpen Fälschungen über angebliche Massenvernichtungswaffen, mit denen der 2. Irakkrieg 2003 gerechtfertigt wurde. Dass dieser Krieg, der die gesamte staatliche Struktur des Irak zerstört hat, Ursache für das Aufkommen der islamistischen Terroristen war, hat nun in einem bei Politikern seltenen Akt der Einsicht sogar Tony Blair zugegeben, immerhin einer der „willigen“ Beteiligten in diesem Krieg. Lüders wirft dem Westen m.E. nach zu Recht vor, zu häufig, aus Ignoranz oder aus reinem Machtkalkül soll dahingestellt sein, die Falschen unterstützt zu haben und die gesamte Region mit seinen Interventionen ins Chaos gestürzt zu haben. Unverständlich auf diesem Hintergrund bleibt dann allerdings Lüders Empfehlung, in den Muslimbrüdern eine Alternative zum Wahabismus der Saudis zu sehen. Note: 2 (ün)<<
>> Der ehemalige Nahostexperte der „DIE ZEIT“ Lüders seziert die gegenwärtige und bis in die Zwanziger Jahre reichende Vergangenheit verschiedener vorderasiatischer und afrikanischer Regionen. Ein Fazit seiner politischen Analyse ist die Anklage an den industrialisierten Westen, der ursächlich die zerstörerische Entwicklung vieler Staaten beeinflusst habe.
Iran. Ohne auf die historischen Eigenarten distinkter Staaten oder Aspekte des Kolonialismus einzugehen, verortet Lüders den entscheidenden Sündenfall des Westens im Putsch des Jahres 1953 im Iran. Im iranischen, von den Briten erschlossenen Abadan wurde 90% des damals in Europa gehandelten Erdöls raffineriert. Weil nur 15% der Einnahmen dem Iran zugutekamen, entwickelten sich politische Unruhen. Aus der folgenden demokratischen Wahl ging die Nationale Front mit ihrem in der Schweiz ausgebildeten Rechtsanwalt Mossadegh als Sieger hervor, der als Premierminister die Verstaatlichung der Erdölindustrie und die Einengung der Autokratie des Schahs betrieb. In dem darauf folgenden Putsch und durch die Inhaftierung von Mossadegh gelang es den britischen und amerikanischen Geheimdiensten M6 und CIA stattdessen Schah Reza Pahlevi zu inthronisieren, den Ölnachschub zu sichern und direkt benachbart zur Sowjetunion einen amerikanischen Militärstützpunkt zu installieren. Dieser darauf 26 Jahre andauernde Zustand habe
– laut Lüders – die Grundlage für die iranische Revolution 1979 gelegt. Dabei sei nicht nur Ayatollah Khomeini im schiitischen Iran an die Macht gekommen. Auch der islamische Fundamentalismus habe dadurch in vielen sunnitischen Ländern von Marokko bis Indonesien seinen Big Bang erlebt. Die Entwicklung ging auf Kosten säkulärer, nationalistischer und pro-westlicher Strömungen.
Afghanistan. Amanullah Khan wurde erster König nach der Unabhängigkeit 1919. Seine Modernisierungsversuche des mittelalterlichen Landes in Anlehnung an Atatürks Reformen in der Türkei scheiterten jedoch an landesweiten Aufständen der Landbevölkerung, regionalen Clans und der Geistlichkeit. Mit Khans Sturz wurden Schulpflicht, Schulmöglichkeit auch für Mädchen und allgemeine Alphabetisierung unerreichbar. Der entbrannte Bürgerkrieg wurde von den konkurrierenden Weltmächten Sowjetunion und USA nach Kräften befeuert. Den USA gelang es mittels durch die CIA unterstützter Mudschahedin, die Sowjetunion zur Invasion zu provozieren und sie damit in ein zweites „Vietnam-Abenteuer“ zu locken. Nach 10 Jahren mussten die Sowjets den Kampf erfolglos und wirtschaftlich ausgeblutet abbrechen. Damit sei laut dem amerikanischen Sicherheitsberater Brzezinski das überhaupt wichtigste Ziel, der Zusammenbruch des Sowjetsystems, erreicht worden. Für dieses geopolitische Ziel habe es Afghanistan als Plattform gebraucht. Laut Lüders habe sich im folgenden Chaos Al-Qaida und später Osama bin Ladens Taliban etablieren können.
Überlagert wurde und wird die Situation von konkurrierenden islamischen Kräften. Das sunnitische Saudi-Arabien versucht den erzkonservativen Wahabismus in der gesamten islamischen, überwiegend sunnitischen Welt zu verbreiten und zu dominieren. Der vor allem von muslimischen Jugendlichen präferierte Salafismus als „Wahhabismus light“ mit seiner idealisierten Rückbesinnung auf das 7. Jahrhundert gerät dabei genauso in militärische Konkurrenz wie Al-Qaida, Taliban und der sunnitische Islamische Staat IS. Allen gemeinsam ist u.a. das Prinzip „takfir“, das die Liquidierung aller muslimisch- und nicht-muslimisch Andersgläubigen fordert. Unterschiedlich sind in den verschiedenen sunnitischen Strömungen jedoch die Loyalitäten: entweder gegenüber dem saudischen König, oder dem IS Kalifen oder dem Nachfolger Osama bin Ladens. Diese Unterschiede machen die meisten Fraktionen zu Todfeinden, so dass eine Viel-Fronten Konfrontation die logische Konsequenz ist.
Irak. Der Irak wurde bereits seit mehreren Jahrhunderten trotz ihres Minderheitenstatus von einer sunnitischen Machtelite regiert, als Saddam Hussein unter dem Dach der arabisch-nationalistischen Baath-Partei die Macht ergriff. Die 80% Mehrheit von Kurden und Schiiten hatte auch nach dem ersten Weltkrieg im künstlichen Staatsgebilde Irak weiterhin das blutgetränkte Nachsehen. 1980 versuchte Saddam Hussein vergeblich sich in einem verlustreichen Krieg Öl-reiche Regionen des Irans einzuverleiben. Der schiitische Iran antwortete u.a. mit einer halben Million geopferter Kindersoldaten als menschliche Minenräumkommandos. Das Massensterben endete mit einem Patt und gigantischen Staatsschulden des Irak nach acht Jahren. Um der entstandenen Schuldenlast zu entkommen, überfiel das Hussein Regime 1990 Kuwait, womit der weltweit größte Öllieferant entstanden wäre. Eine von den USA geführte Koalition befreite innerhalb von 6 Wochen Kuwait. Die Kosten von über 60 Milliarden Dollar trug zur Hälfte Saudi-Arabien. Deutschland zahlte ebenso mehrere Milliarden ohne jedoch militärisch direkt einzugreifen. 2003 wurde in dem Krieg der Willigen das Regime liquidiert und Hussein schließlich 2006 gehängt. Lüders sieht mehrere US-Verantwortungspunkte. 1) Der iranisch-irakischen Krieg wäre nach 2 statt nach 8 Jahren zu Ende gewesen, hätten die USA nicht das Hussein Regime militärisch gerettet, da der Iran schon die Übermacht gewonnen hatte. Die USA wollten jedoch auf keinen Fall eine Stärkung des Iran zulassen. 2) Dass die USA Kuwait befreiten, sei honorig. Den USA sei jedoch vorzuwerfen, dass sie anschließend Hussein und sein Regime im folgenden Irakkrieg mit Lügen von Massenvernichtungswaffen verteufelten. 3) Nach dem Sieg hätten die USA den folgenschweren Fehler gemacht, die Sunniten-dominierte Baath-Partei zu verbieten. In der Folge hätten sich die jetzt politisch heimatlosen Aktivisten zu neuen Guerilla Einheiten gegen die neuen schiitischen Machthaber zusammengeschlossen. Späte Folge des US initiierten Chaos sei die Entstehung des IS.
Angefeuert wurde bzw. wird der desolate Zustand im Irak durch die Regionalmächte Iran und Saudi-Arabien, die jeweils die schiitischen bzw. sunnitischen Fraktionen militärisch unterstützen. Der konfessionell aufgeladene Bürgerkrieg hat somit eine Stellvertreterfunktion und fordert nach wie vor monatlich 3.000 Tote. Ein ähnlich trauriges Schauspiel liefern sich beide Regionalmächte gegenwärtig im Jemen, wo die schiitischen Huthi-Rebellen als IS-Ableger gegen die sunnitische Machtelite angetreten sind.
Syrien. Das machtpolitische Syrien ist schiitisch und enger Verbündeter des schiitischen Irans. Damit ist Syrien natürlicher Feind der USA (und Israels). Vor allem in Syrien kollidieren erneut geopolitische Ambitionen, da hier Russland seine einzige Mittelmeerbasis unterhält und ebenso auch von China gegen den kapitalistischen Westen gestützt wird, während Europa – allen voran Frankreich 2012 mit Sarkozy – den Sturz des Diktators (vergeblich) betrieb/betreibt. Ausgangspunkt ist der arabische Frühling 2011, als sich Bevölkerungsteile gegen das Regime erhoben. Seitdem verteidigt Assad mit noch größerer mordenden Konsequenz die Macht gegen sunnitische Aufständische. Neben den militärisch organisierten Hauptakteuren Assad-Regime, Kurden im Norden, Nusra-Front/Al-Qaida und konkurrierender islamischer Staat IS gibt es vermutlich mehr als 1.000 Fraktionen von Warlords, konkurrierenden Clans, und lokal marodierenden Milizenfraktionen, die keine politischen Ziele sondern persönliche Bereicherung verfolgen. Hier sind also höchst gefährlich völlig unübersichtlich metastasierende Gewaltgeschwüre aller Größenordnungen mit geopolitischen Globalinteressen verquickt, so dass eine Parteinahme fast unmöglich wird.
Lüders erhebt an dieser Stelle den Vorwurf, dass man Assad nicht hätte abkanzeln dürfen. Das Blut-Vergießen wäre dann geringer ausgefallen. An anderer Stelle formuliert der Autor jedoch entgegengesetzt den Vorwurf, dass der Westen mit Gewalttätern zusammenarbeitet, was prinzipiell verwerflich sei. Oder dass der Westen zu einem Zeitpunkt mit Aufständischen zusammenarbeitet, die zu einem späteren Zeitpunkt zu ihren Feinden werden (s. Afghanistan/Taliban/Osama bin Laden).
Arabischer Frühling. Die Arabellion 2011 hat mit Ausnahme von Tunesien in keinem arabischen Land zu nachhaltigen Veränderungen im Sinne von Rechtstaatlichkeit geführt. Im Gegenteil versinken Regionen wie Libyen, Syrien, Jemen, Afghanistan und der Irak in Zustände wie sie im Dreizigjährigen Krieg in Europa kaum besser waren. Eine entscheidende Ursache sieht Lüders darin, dass die Gesellschaften weder in Ihrer Strukturentwicklung (noch in ihren Wertevorstellungen, Anmerkung) reif für zeitgemäße Staatlichkeit sind. Wichtigstes, weil stabilisierendes Merkmal sei das Fehlen ausgeprägter Mittelschichten. So hätte Mubarak nach drei Jahrzehnten in Ägypten gestürzt, die folgende Sisi-Militärregierung nicht aber verhindert werden können. Entsprechend bewirkten zwischenzeitlich die freien Wahlen, die aus westlicher Sicht mit der Moslembrüderschaft ohnehin den „falschen“ Wahlsieger hervorbrachten, einen katastrophalen Systemrückschritt. Ebenso hätte die Liquidierung von Gaddafi und Saddam Hussein Libyen und den Irak in ein brutalisiertes Chaos gestürzt, welches als Kollateralschaden nach Syrien ausstrahlend noch den IS hervorgebracht hätte. Gleichzeitig formuliert Lüders, dass der Ölreichtum Libyens ausreichen würde, allen 6 Millionen Einwohner einen Schweizer Lebensstandard zu ermöglichen. Eigennutz, mittelalterliche Denkstrukturen und Wertekanons inklusive der Blutrache sowie parasitäre Klientelwirtschaft großer und kleinster Machthaber vor Ort verhindern jedoch jeden sozialen Ausgleich. Die Folge ist, dass Libyen unregierbar geworden ist.
Die Gründe, warum allein Tunesien einen wenn auch labilen Wandel zum Besseren schaffte, sieht Lüders in verschiedenen Teilaspekten. Dazu zählen eine gut verwurzelte Zivilgesellschaft, eine relativ breite Mittelschicht, geringere soziale Gegensätze, eine starke Gewerkschaftsbewegung, eine untergeordnete Armee (anders als in Ägypten) und inzwischen eine 2014 ratifizierte Verfassung mit Trennung von Staat und Kirche, Glaubensfreiheit, Gleichstellung von Frauen und der Verurteilung von „takfir“ und eben kein Platz für eine Scharia-Rechtsprechung.
- Der Islamische Staat IS ist personell aus irakischen Milizen hervorgegangen, folgt sunnitischen Grundgedanken und steht damit den schiitischen Machtzentren im ehemaligen Irak und Syrien (und Iran) konträr entgegen. Die kompromisslose Radikalisierung greift religiöse Urformen des Islam (Wahabismus) auf und integriert sie in eine Staatsidee in Form des Kalifats. Damit gibt sie vielen Arabern eine konstruktivere Identifikationsfläche als z.B. Al-Qaida mit dem perspektivarmen 9/11 Terror. Nicht überraschend stehen Al-Qaida und IS in Konkurrenz zueinander. Ebenso Saudi-Arabien und IS, die beide um das ideologische Führungsprimat ringen: die Geister, die der Wahabismus rief, könnten ihren Lehrmeister vom Thron stürzen. Das Erfolgsrezept des IS ist u.a. seine in der Bevölkerung gefürchtete Gewalttätigkeit, die z.B. konsequente Exekution von andersgläubigen Kurden und Schiiten praktiziert. Gleichzeitig stabilisiert der IS seine staatlichen Strukturen, organisiert offensichtlich professionell das kommunale Leben und schafft für sich-unterordnende Mitglieder ein geregeltes Alltagsleben. Im Herbst 2015 hat der IS bereits 6 Millionen Einwohner und die Hälfte Syriens und große Teile des Irak unter seiner Kontrolle.
Kurden. Die Kurden sind wie die Palästinenser ein Volk ohne Staat, da es sich nach dem ersten Weltkrieg durch die ehemaligen Kolonialmächte Frankreich und England auf die vier Staaten Türkei, Syrien, Irak und Iran aufgeteilt sah. Kurden stellen keine homogene Population dar, sondern vereinen zwei einflussreiche Strömungen: eine feudalstaatlich und eine sozialrevolutionäre, zu der die PKK zählt, welche mit Religion und traditionellen Stammesstrukturen gebrochen hat. Die Kurden im Nordirak haben vom Staatszerfall des Irak profitiert und stehen kurz vor der Unabhängigkeit. Die Region ist mit ihrem Ölreichtum wirtschaftlich eine Boomregion. Die Türkei nutzt verhalten die irakischen Kurden gegen den IS, reglementiert jedoch die Kurden in der Türkei aufs Schärfste. Deutschland definiert die kurdischen Streitkräfte des Nordirak (Peschmerga) als „gut“ und unterstützt deren Kampf gegen den IS mit Waffen. Gleichzeitig stuft Deutschland die PKK, die hier die meisten Frontkämpfer gegen den IS stellt, als Terrororganisation ein.
Israel. Palästinenser. Palästinenser sind auf die beiden nicht-zusammenhängenden Territorien Westjordanland und Gazastreifen aufgeteilt, deren verfeindete Automoniebehörden Fatah (West Bank) und Hamas (Gaza) sunnitisch ausgerichtet sind. Der Gazastreifen mit 1,8 Millionen Einwohnern wird laut Vereinten Nationen 2020 nicht mehr bewohnbar sein, aus Mangel an fehlenden Ressourcen u.a. bedingt durch anhaltende, israelische Kriegsschäden. Im Laufe der Staatsgründung vertrieben die Juden 800.000 Araber aus ihrem neuen Staatsgebiet. Gegenwärtig wird das Westjordanland von Israel sukzessive durch eine aggressive Okkupationspolitik und Ansiedlung jüdischer Bürger zerstückelt. Die israelische Annexion von Ländereien des durch die UN garantierten unabhängigen Westjordanland bleibt ungesühnt. Das gleiche gilt für die israelische Zerstörung von Einrichtungen im Gazastreifen, die von der EU finanzierte Hilfsprojekte darstellen. Ein Beispiel ist der Flughafen in Gaza. Statt Israel zur Verantwortung zu ziehen, reagiert die EU mit erneuten Hilfsfinanzierungen. Militärisch und wirtschaftlich wird Israel am stärksten von den USA unterstützt. Gleichzeitig arbeitet Deutschland sich seit 70 Jahren mit Sonderprogrammen an seiner historischen Schuld ab, indem für das jüdische Israel z.B. Kriegsgroßgeräte wie Korvetten und acht U-Boote mit zwei Milliarden Euro durch deutsche Steuergelder subventioniert werden. Moralisch sieht Lüders den Westen und vor allem Deutschland in einer schizophrenen Situation. Kriegstechnisch organisierte Massenmorde durch Israel an Palästinensern werden als Selbstverteidigung definiert, Intifada Morde der Palästinenser an Juden als Terror. So gibt es auch keine offizielle, deutsche Kritik an der amtierenden Israelischen Justizministerin Shaked zu Tötungsaufrufen bzgl. palästinensischer Mütter, die sonst noch mehr Märtyrerschlangen gebären würden. Ebenso bleiben die Ethnokratiebestrebungen Israels unkommentiert. 2014 hatte Israel in einem Gesetz Israel zum Nationalstaat des jüdischen Volkes erklärt und Arabisch als zweite Amtssprache abgeschafft. Da die Bevölkerungsentwicklung in absehbarer Zeit die nicht-jüdischen Araber zur Mehrheit machen wird, soll das neue Gesetz ihre Entrechtung und eine gesetzlich verankerte Ethnokratie analog der südafrikanischen Apartheid ermöglichen, schreibt Lüders.
Perspektiven. Was sind die Perspektiven? Lüders vermutet, dass – im Gegensatz zu säkulären Industrienationen – im arabischen Raum nur jene Protestbewegungen eine Chance haben, die islamisch verwurzelt sind. Der herrschende Bezugsrahmen aller Bevölkerungsgruppen in den verschiedenen Ländern sei zu tief im islamischen Glauben verankert. Im Grunde legt Lüders dar, dass die arabischen Nationen nicht reif seien für die Freiheitsbegriffe (Rechtsstaatlichkeit, Gleichberechtigung…) wie der Westen sie praktiziert. Dazu bräuchte es eine robuste Verankerung dieser Prinzipien im Kopf jedes Einzelnen einer Gesellschaft. Dass dieser millionenfache Lehr – und Lernprozess auch in Europa unglaublich schwer und mühsam war, über Jahrhunderte ging und Millionen von Toten forderte, ist wahr aber natürlich nicht tröstlich. Der arabische Raum ist so gesehen noch in einer blutgetränkten frühen Lernphase, dessen Ende nicht absehbar ist. Das Ergebnis für den Westen ist eine neue Unübersichtlichkeit. Vielerorts entstehende Machtzentren unterschiedlicher Größenordnungen tragen zu einer schwer kalkulierbaren Multipolarität bei.
Die Kritik von Lüders an den Industrienationen, allen voran an den USA, fällt auf Grund ihrer Mitverantwortung harsch aus und reicht von wirtschaftlicher Selbstbereicherung, über humanitär begründeten Imperialismus, politische Ignoranz bis zu militärischem Machtstreben. Auch wenn der Autor sich offensichtlich in Bewertungswidersprüche verstrickt (z.B. Tyrannen liquidieren versus mit ihnen kooperieren), sind die Darstellungen kenntnisreich, erhellend und lesenswert. Lüders aktionspolitisches Fazit ist: bescheidener agieren, teilen und soziales Gefälle mindern, potentiell friedenstiftende Angebote machen, gelegentlich bei überschaubaren (?) Konflikten militärisch eingreifen und dennoch den humanistischen Wertekanon nicht aufgeben.
Was der Autor nicht sagt: Für die deutsche Außenpolitik könnte empfohlen werden, sich weder passiv (Waffenlieferungen…) noch aktiv an militärischen Konflikten zu beteiligen, sondern Nationen und Völkern ihre Wege und Irrwege zuzugestehen, wenn sie denn von den anderswo gelebten Alternativen nicht zu überzeugen sind. Für den heimischen Zuschauer bedeutet dies natürlich, dass er auch viel mehr als bisher damit zurechtkommen muss, dass der Mensch massenhaft und vielerorts unglaublich brutal verhält. Ein Faktum, dass auch im historischen Europa ganz natürlich schien, dank unserer ethischen Entwicklung jedoch mancherorts in Vergessenheit geraten ist.
Note: 3+ (ur)<<