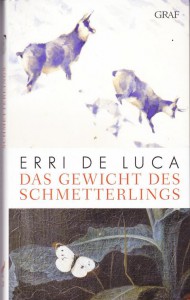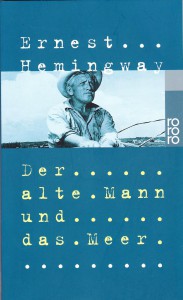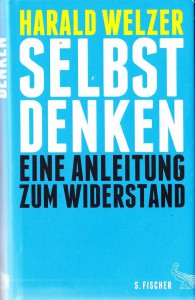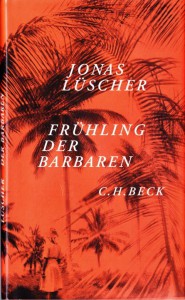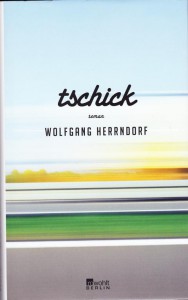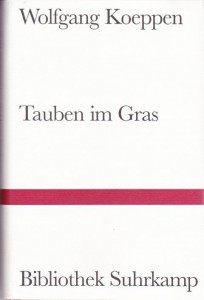Luchterhand 2009, 591 Seiten.
Luchterhand 2009, 591 Seiten.
>> Hanns, man schreibt ihn mit zwei n
Lehrer nannten ihn blemblem.
Oh, war diese Kindheit schwer
Mutter dominiert ihn sehr
Mutter-Sohn, als Symbiose
eine komplizierte Chose.
Später dann im alten Rom
vor dem schönen Petersdom
wurd es besser, Stück für Stück
‚Freundin Clara plus Klavier,
sorgen konsequent dafür.
Dieses Buch zeigt wie Musik
beiträgt zu der Menschen Glück.
Doch Hand wird krank, ja so ein Mist
plötzlich Schluß mit Pianist.
Hanns-Josef kämpft, gewinnt im Spurt
Happy End in Klagenfurt.
Und der Leser glaubt es kaum,
alles endet wie im Traum.
Note: 3+ (ax) <<
>> Einen Einblick in seine bedrückende Kindheit und Jugend, die der Autor aus dem Abstand von über 50 Jahren und aus der räumlichen Distanz Rom freigibt . Johannes als Fünftgeborener erfährt erstmals als 7jähriger am Tag fast seiner Einschulung von seinem Vater die Ursache für die Stummheit seiner Mutter. Nach dem Tod ihrer vier ersten Kinder verliert sie die Sprache, ein Trauma, das auch Johannes nach seinem 3. Lebensjahr einholt. Stummes Kind und stumme Mutter bilden von da an eine symbiotische Schicksalsgemeinschaft. Der „skurrile Autismus“ führt zum Leben eines „Geheimbundes“, das sich „nach festen Regeln und in einer großen Stille“ vollzieht, all dies unter der Obhut eines liebevollen Vaters, dem allein der kleine Schriftverkehr der Mutter (sorgfältig beschriebene Zettlchen) die Alltagswelt von Ehefrau und Kind offenbaren. Dass sich unter diesen Umständen bei Johannes auch ein Vaterbild als „Frohnatur“ einstellt, irritiert. Die scheinbare Geborgenheit nach innen bedingt den Rückzug aus der Außenwelt. Mitleid aber auch Spott verspürt Johannes und so ist wenig verwunderlich, dass ihm der Glaube „ein Fundament“ der Sicherheit gibt. Ein Klavier des Pfarronkels aus Essen bringt die Wende, nicht behutsam, sondern fortissimo. Die stumme Mutter erweist sich plötzlich als virtuose Pianistin („Ich starrte Vater an und sah, wie entgeistert er war…als habe ihn die Musik geschockt“) und die ersten Berührungen der schwarz-weißen Tasten durch den 6jährigen Johannes markieren „die eine Sekunde, die über mein ganzes, weiteres Lebens entschied“. Das Klavierspiel als „Befreiung und Ende der demütigenden Tage“ und als „Ausweg aus dem Idiotendasein“, wird zum zentralen Thema des Romans. Wir verfolgen einerseits den Aufstieg des stummen Kindes zum musikalischen Genie (Passagen des Romans geraten zum Musiktelekolleg) und dessen tragisches Scheitern, andererseits die „Vereinsamung“ des Kindes und dessen Unfähigkeit zu sozialen Bindungen als Jugendlicher. Letzteres zeigt der vom Vater gewünschte Besuch der Grundschule ebenso wie der spätere mit Hilfe des Kölner Musikgurus Fornemanns vermittelte Internatsaufenthalt des 12jährigen Johannes. Dagegen gelingt die „Geschichte der Sprachwerdung“ mit Hilfe des Vaters in der ländlichen Rückzugsidylle der Großeltern(der Vater verordnet Muttertrennung!) jenseits staatlicher Institutionen . Die Passagen des bildhaften Spracherwerbs von Johannes, eingebettet in die intensive Naturerfahrungen von Vater und Sohn zählen zu den Stärken des Romans, wenn auch die Geschichte des „ersten Satzes“ mit einem Pathos zelebriert wird, das angesichts des Ergebnisses „Gebt mal her“ verpufft. Die Szenerie des Landaufenthalts erfährt mit dem unerwarteten Erscheinen der nackten Mutter an jenem einsamen Waldseechen, das für Johannes im wörtlichen Sinne „frei schwimmen“ bedeutete, eine ödipale Dimension. Die Verwandlung der stummen Mutter zur singenden Nymphe – ihr Bad trägt Züge einer rituellen Reinigung – angesichts des zwischen „Entbehrung“ und „Begehren“ überwältigten kindlichen Beobachters missglückt allerdings zum Psychokitsch. Ob autobiographisch verbürgt oder wie so manches im Roman wiederum eher der literarischen Dramaturgie geschuldet, ist die 2. Mutter-Sohn Begegnung am Fluss. Der Mutsprung Johannes vom Felsplateau bedeutet nicht nur die lebenslange Überwindung von Angst, sondern angesichts der wie aus dem Nichts auftauchenden Mutter den endgültigen Schritt aus mütterlicher Bevormundung. Sein gegen die Hilfeschreie der Mutter „Spring nicht“ vollzogener Akt der Befreiung befreit die Mutter aus ihrer Stummheit. Das „absolute Schweigegebot“ innerhalb der Familie über das Trauma der Mutter wird erst während der Gymnasialjahre von Johannes während der sog. „Essener Tage“ von Onkel Hubert durchbrochen, jener Pfarronkel, der das Schicksal von Johannes ohne es zu ahnen im wesentlich bestimmt. Leitet dessen Klavier der Marke Sailer die Karriere eines musikalischen Genies ein, so weisen seine Erzählungen über das Theologiestudium in Rom den weiteren Weg, einen Weg, den Johannes bei seiner 1. Ankunft 1972 in Rom als „eine einzige große Befreiung empfindet“. Und in der Tat offenbaren die römischen Notizen hinter dem bildungsbeflissenen Conservatorio-Schüler eine Johannesfigur, die vor allem in der Clara-Episode eine erotische Dimension erhält, die zeigt, dass im Kölner Einzelgänger erfreulicherweise mehr als Schumann und Bach lodert . Überhaupt öffnet Rom in vielfältiger Weise das Fenster nach außen: die Musik wird öffentlicher, die Kleidung leichter für den begehrlichen Sprung ins Abseits, man trifft sich mit Freunden, Hinterhofparlando, neben Kirchenkult und Petersdomfaszination treten Schauplätze wie Bars und Cafes. „Das schöne Lebens zu zweit“, das Johannes „an die Stelle des früheren, innigen Lebens mit seinen Eltern“ setzt und die Pianistenlaufbahn werden durch die Diagnose „Sehnenscheidenentzündung“ plötzlich beendet. War Rom auch als Abschied von den Eltern gedacht, so führt das Scheitern gerade dorthin zurück und mit demselben Pathos mit dem die Ewige Stadt als Heimat glorifiziert wird, erklärt der 20jährige, kaum dass er das einsam gelegene Elternhaus betritt: „Ich werde mein Elternhaus nie mehr verlassen…ich werde von nun an zusammen mit meinen Eltern leben und mich nie mehr von ihnen entfernen…ich werde studieren noch einen Beruf anstreben, ich werde überhaupt nichts anstreben“. Diese Regression durchbrochen zu haben, verdankt Johannes neben seinem schriftstellerischen Talent vor allem seinem musikalischen Förderer Fornemann, der sich auch als gewiefter Strippenzieher in Sachen literarischer Markt erweist. Und wir verdanken Fornemann und den Klagenfurter Kritikern die Förderung eines Autors, der seiner stummen Kindheit Jahrzehnte später eine eigene Sprache verleihen kann. Dass diese Aufarbeitung der Vergangenheit am Schauplatz Rom geschieht, ist nicht zufällig. Mit der Antonia-Marietta-Handlung, die den Schreibprozess immer wieder unterbricht, erleben wir den inzwischen erfolgreichen Autor als Romenthusiasten. Doch wer glaubt Antonia erwecke Clara- Stürme sieht sich bitter enttäuscht. Vielmehr scheint der Autor mit der musikalischen Domestikation der 12jährigen Marietta nochmals seine eigenen Pianistenträume verwirklichen zu wollen. Ob imaginiert oder real – selbst der vom Autor inszenierte erste öffentliche Auftritt Mariettas wird letztendlich zur Apotheose auf den wahren „pianisti“: Liebe Freundinnen und Freunde, sagt das Kind, Giovanni wird jetzt zum Schluss noch selbst etwas spielen. Bitte, Giovanni, nun kommt Dein Auftritt.“ Etwas weniger Eitelkeit, etwas weniger Geniekult, etwas weniger Schumann, etwas mehr wirkliches Leben und weniger Kladden – „Die Erfindung des Lebens“ hätte mehr berührt. Note: 3 (ai)<<
>> Was für eingroßartiger Stoff! Obwohl Handwerklich sicher gekonnt, führt aber doch manch großspurig angelegter Spannungsbogen enttäuschend ins Leere und die Geschichte zieht sich zunehmend mit ermüdenden Wiederholungen. Das Getue um die Klavierkünste des Protagonisten ist schlicht nervig, am Ende gar peinlich. Note: 3 (ün)<<
>>Wer seine Sprache zweimal verliert, wird zum Schriftsteller. Sprache, Mitteilung, dem inneren Druck von Kommunikation, die gelebt werden muss, nachgehen und nachgeben, das ist eine Lehre, die das Leben von Ortheil prägt. Sprache drängt aus dem Menschen heraus, gibt ihm Gleichgewicht und wiegt so schwer im Miteinander. Sprache – das ist für Ortheil nicht nur das Wort sondern auch Klang, der sich in seinem Leben zu gelebter Musik verdichtet. Der Anlass, ein herausragender Pianist zu werden, war bezeichnender Weise der Verlust des Sprechens. Klavierspiel war fortan in seinem Leben das Therapeutikum, um die isolierende Stummheit zu überwinden. Als tragischer Weise schließlich das Klavierspielen unmöglich wurde, und der Pianist in ihm starb, wurde der Schriftsteller geboren, den wir heute kennen. Der autobiographische Roman ist ein eindrucksvolles Manifest einer schicksalhaften Ich-Werdung mit, gegen und durch die Sprache.
Der kleine Johannes (Ortheil) wächst in der stillen Kölner Mietwohnung seiner Eltern ohne Geschwister auf, nachdem seine Mutter durch Kriegsangriffe und Fehlgeburten ihre ersten vier Söhne und bedingt durch die traumatischen Erfahrungen auch die Sprache verloren hatte. Nach zunächst normaler Sprachentwicklung versinkt der dreijährige Johannes in symbiotischem Schweigen. Er teilt die Stille mit der Mutter, die ihn auf Engste an sich bindet. Die Mutter-Kind-Einheit wird vom als Landvermesser arbeitenden Vater geduldig umsorgt mit einer Verständigung mittels Zetteln, die täglich in großer Zahl von der Ehefrau geschrieben werden. Die umschwiegenen Ohren des Jungen machen seinen Augen Platz, die umso aufmerksamer die Welt aufsaugen. Als das Schulalter über die Kleinfamilie hereinbricht, sind weder Mutter noch Johannes den Veränderungen gewachsen: die Symbiose droht zu zerbrechen, der ewig schweigende Junge wird als geistig behindert in der Schule ausgegrenzt und das anfängliche Bemühen des Lehrers verkehrt sich ins Gegenteil. Trost spendet nur ein Klavier, auf dem Johannes ungewöhnlich ausdauernd übt. Die ungezählten täglichen Stunden machen es zu seinem musikalischen Freund, den einzigen, den er lange Zeit haben wird.
Als der Schulalltag eskaliert, vollführt der besorgte Vater einen radikalen Schnitt, löst sich von seiner Arbeit, trennt Mutter und Sohn und wechselt mit Johannes für viele Monate in sein Heimatdorf im Westerwald. Hier werden sie wie selbstverständlich in den großen Gastwirtschaftsbetrieb seines Bruders aufgenommen und in das emsige Schaffen eingebunden. Vater und Sohn machen täglich lange Wanderungen. Im angestammten Terrain des Landvermessers lehrt der Vater das Betrachten und malerische Wiedergeben der Natur. Der Sohn folgt beeindruckt bis eines Tages das angestrebte Wunder vollbracht wird. Durch die Verbindung von zeichnerischem Erfassen und Schreiben dazugehöriger Worte („Das ist eine Eiche“) öffnet Johannes ein kognitives Tor, das ihm annährend grenzenlos eine einfache Syntax ermöglicht. Intuitiv gelingt dem Vater eine didaktische Methode zu finden, die dem Sohn den Zugang zur Sprache ebnet.
Die Mutter ringt während dessen mit ihrem eigenen Schicksal und vertieft sich ihrerseits in das Klavier spielen bis der Vater ihrem Besuch auf dem Lande zustimmt, der einen weiteren Damm brechen lässt. Als sie ihren Sohn zusammen mit anderen Kindern von einem Felsen in den Fluss springen sieht, schreit sie ihre Todesangst dem Sohn entgegen. Der Verlust der Söhne raubte ihr die Sprache, die Angst den letzten Verbliebenen zu verlieren, gibt ihr die Sprache zurück. Fortan wird sie wie in früheren Jahren als eine eloquente, feinsinnige Erzählerin in angeregten Unterhaltungen beeindrucken. Für Johannes wird die Begegnung am Fluss zu einem willensstarken Akt der Emanzipation: er will sich nicht mehr dem Diktat der Angst unterwerfen und behauptet bis heute, daraufhin nie wieder im Leben – egal in welchem Kontext – Angst gehabt zu haben. Entsprechend darf vermutet werden, dass aus der schicksalhaften Enge seines Kinderlebens kompensatorisch ein unbändiger Durchhaltewille gepaart mit einem enormen Ehrgeiz entsprungen ist. An einem der Folgeabende treten Mutter und Sohn konkurrierend gegeneinander auf. Die Mutter fasziniert die versammelte Belegschaft mit ausuferndem Klavierspiel bis Johannes sich erhebt um zum ersten Mal in der Öffentlichkeit zu sprechen. Als die völlig überraschten Gäste verstummen, holt Johannes zu einer langen Litanei kurzer Hauptsätze aus wie er sie in Verbindung mit seinen Zeichnungen gelernt hat: „ Das ist eine Eiche …“.
Nach längerer Zeit kehren sie nach Köln zurück, wo Johannes eine andere Schule besuchen und vor allem durch talentiertes Klavierspielen auffallen wird. Um seine musikalische Begabung zu fördern, wird er fortan von einem berühmten Pianisten unterrichtet und schließlich in ein bayrisches Elite–Musik-Internat überwechseln. Die ständige, ungewohnte Nähe zu Schulkameraden lassen diesen Ausbildungsschritt jedoch scheitern.
Nach dem späteren Schulabschluss erleben wir Johannes in einer neuen Welt. Angeregt durch viele Wanderungen und Reisen mit dem Vater bricht er nach Rom auf, das ihn augenblicklich verzaubern wird. Das Licht, das Blau, die Menschen, der Gesang der Sprache, das völlige Eintauchen in die Musik und vor allem die erste Liebe werden die folgenden zwei Jahre zu den schönsten seines Lebens machen. Mit Clara wird er völlig verschmelzen, die Liebe der Seelen und der Körper wird sie fesseln – unterbrochen nur von den zügigen Piano Fortschritten am Konservatorium. Freunde scharen sich um die beiden. Eine Berühmtheit entwickelt sich um den reifenden Pianisten. Das Leben ist unumwunden herrlich. Der rapide Abbruch kommt mit einer nicht therapierbaren Sehnenschädigung der Pianistenhände. Die Schmerzen machen das Musizieren unmöglich. Der monotone Blick auf das eigene Schicksal mit dem Verlust einer sicher geglaubten Karriere lastet auch unverhältnismäßig auf der Beziehung, die wenig später zerbricht. Hier holt Johannes die ausladende Ich-Bezogenheit, die ihm in früheren Jahren zu überleben half, ein und zerstört seine Aufmerksamkeit für Clara.
Nach Hause zurückgekehrt, wird er fortan ein zurückgezogenes, von den Eltern jedoch verständnisvoll unterstütztes Leben in der idyllischen Enklave im Westerwald führen. Zu diesem Zeitpunkt begleiten ihn vor allem tausende von Tage- und Notizbüchern, die er das ganze Leben lang verfasste. Eine schicksalhafte Begegnung mit seinem ehemaligen Klaviermeister weist ihm den Weg: er möge das aufgreifen, was ihm immer begleitete: seine geschriebenen Worte. Der Meister überzeugt ihn, die Tagebücher mit der so ungewöhnlichen Lebensgeschichte zusammenzufassen und zu veröffentlichen. Tatsächlich gelingt das Experiment. Auf Anhieb findet sich ein Wettbewerb, wird ein Sieg errungen und ein Verlag überzeugt: der Schriftsteller, der er eigentlich schon immer war, ist nun auch realiter geboren. In Verbindung mit dieser Entwicklung beschreiben eingestreute Kapitel eine zweite Romreise, die Johannes als längst Erwachsener unternimmt, um seine Lebensgeschichte zu überarbeiten. Der römische Alltag spiegelt frühe Ereignisse: der Tochter seiner Nachbarin wird eine Klavierkarriere vorbereitet, Johannes schlüpft in die Rolle des Klavierlehrers, er selbst gibt nach Jahrzehnten wieder ein öffentliches Konzert, welches begeistert aufgenommen wird. Erotische Schwingungen verbinden ihn mit der Mutter seiner Klavierschülerin. Das Leben kann so schön sein.
Eine beeindruckende Lebensgeschichte, die nicht nur auf Grund ihrer vermutlich weitgehenden Authentizität berührt. Dies vor allem in der Beschreibung der Kinderjahre, in denen der kleine schutzbedürftige Junge seiner vom Schicksal zutiefst verfolgten Mutter selbst Schutz gewährt und damit seine eigene Entwicklung blockiert. Beeindruckend der Vater, dem man als Zahlen-gebärenden Beamten nicht die pädagogische Intuition zutraut, ein tragisches Familienschicksal aufzufangen. Er macht eine schon fast verlorene Seele nicht nur alltagstauglich, sondern verhilft ihr zu Stationen des Glücks. Und darüber hinaus verwöhnt uns das Werk mit poetischen Szenen römischer Erotik. Leider überrascht die Romanlandschaft stellenweise aber auch mit sprachlichen Flachgebieten, begleitet von einer mitunter ermüdenden Selbstverklärung, wenn es um die Genialität des Pianisten geht. Entsprechend hätte der Roman von einer deutlichen Kürzung des Umfangs profitieren können. Eine Geschichte, die als Kinofilm noch gewinnen könnte.
Note: 2– (ur)<<
 Fischer Bücherei 1970, 138 Seiten.
Fischer Bücherei 1970, 138 Seiten.