Paul Zsolnay Verlag – 268 Seiten – 1995 / 2000
>>Der Chronist der Winde ist José, ein Bäckergehilfe in einem von verblendeten Revolutionären und ehemaligen Kolonialmächten tyrannisierten westafrikanischen Küstenland. Er ist Echo eines grausamen Windes, der in Gestalt menschlicher Unbarmherzigkeit das Dasein austrocknet. Er ist Chronist des kurzen Lebens des zehnjährigen Straßenjungen Nelio, dessen Schicksal die Widersprüchlichkeit einer ganzen Epoche zu spiegeln scheint.
José findet eines Nachts Nelio angeschossen in dem privaten Theater seiner Chefin, die eigentlich Bäckerin ist. Hartnäckig versucht sie in ihrem kleinen Theater eine naive Utopie im Gegenlicht der vernichtenden Wirklichkeit zu inszenieren. Heimlich versorgt José den schwerstverletzten Nelio und erfährt über die nächsten neun Tage bis zu seinem Tode dessen Lebensgeschichte. Diese neun Tage wirken wie ein religiöser Gegenentwurf, der mit seinem Leid bezeichnenderweise länger dauert als die sieben Tage der Leben schaffenden Schöpfungsgeschichte.
Im Bürgerkrieg wird Nelio von Banditen, die kurz zuvor seine neugeborene Schwester im Hirsemörser zermahlten, entführt. Erst durch den verzweifelten Mord an seinem Aufseher gelingt ihm die Flucht. Alleingestellt findet er schließlich Anschluss an einen mürrischen Liliputaner. Sie irrlichtern durch die Wildnis so wie der Kleinwüchsige schon seit zwei Jahrzehnten orientierungslos umherschweift. Es wirkt wie ein Symbol hoffnungsloser Sinnsuche. Auch wenn die Irrwanderung Nelio in die Heimatlosigkeit führt, schafft sie ausgleichenden Abstand zu den grausamen Erinnerungen. Die märchenhafte Odyssee führt schließlich in die Metropole. Der Großstadt-Moloch verschreckt mit brutalen Gesetzmäßigkeiten und dennoch wird er Haltepunkt für Nelio. Die Seele braucht Heimat.
Schon die erste Begegnung in diesem toxischen Biotop zwingt Nelio erneut in die Rolle des Ausgebeuteten und Entehrten. Ein älterer Taschendieb zwingt ihn zur Gefolgschaft. Er muss Passanten anbetteln, damit der Dieb die abgelenkte Laufkundschaft bestehlen kann. Erst als Nelio ein hohles Reiterstandbild entdeckt, in dem er sich dauerhaft verbergen kann, gelingt die Loslösung.
Nelio umgibt eine ungewöhnliche Aura, die ihm Zugang zu einer Gruppe von Straßenkindern ermöglicht. Es wird seine soziale Einbettung. Mit seiner frühreifen Weisheit avanciert Nelio schließlich zum sinnstiftenden Anführer. Bestimmt, fair, akzeptiert. In einem rechtsarmen Raum lebend vermittelt Nelio den durchweg älteren Kindern intuitiv Grundzüge eines solidarischen Wertesystems. Gleichzeitig wird in einer abenteuerlichen Weise das (unverstandene) Wertesystem der Gesellschaft persifliert. Als mystisches Symbol der machtbesessenen Geschäftswelt vermuten sie tote Eidechsen, nachdem sie eine solche in einem gestohlenen Aktenkoffer entdecken. Ihre kindliche Antwort auf die vermeintliche Logik des Systems ist, selbst tote Eidechsen an Kaufhaus-Kleiderhaken und Palastnischen zu schmuggeln. Die selbstlosen Einbrüche fühlen sich an wie Beweise ihrer Macht. Diese vielfarbigen Anekdoten sind es, die den tiefgrauen Lebensalltag nicht nur für die jugendlichen Opfer, sondern auch für den Leser erträglicher machen.
Unruhe überkommt das Rudel als sich ihnen das von der Nachbarschaft ausgestoßene Albino-Mädchen Deolinda anschließt. Als ihre schwarze Mutter das weiße Kind zur Welt brachte, verstieß ihr Vater seine Frau, weil er überzeugt war, dass sie mit einem Toten geschlafen hatte. Der Widerstand in der Gruppe ist groß bis sie schließlich akzeptiert wird. Als Nelio erfährt, dass sie dennoch vergewaltigt wurde, gerät er außer sich. Der Täter ist das Gruppenmitglied Nascimento. Nascimento ist selbst Opfer einer quälenden Vergangenheit, weshalb Nelio schließlich für Nachsicht plädiert. Die geflohene Deolinda wird jedoch nie wieder auftauchen.
Als der kleine Bomba durch wiederholte Lebensmittelvergiftungen an Leberkrebs zu sterben droht, inszenieren die Jungen in einer rührenden Anstrengung heimlich im Theater der Bäckerin eine Wunschtraum-Vorstellung, die Bomba auf eine Insel des Glücks entführt bis er wenig später dem Tumor erliegt. An diesem Abend werden sie von einem Wachdienst überrascht. Nelio wird dabei lebensgefährlich angeschossen.
Auf dem Dach des Theaters, wo José Nelio bis zum Tode pflegt, liegen Traumwelt des Theaters und Nelios existenzbedrohende Wirklichkeit sinnbildlich übereinander. Was für Nelio nur bleibt, ist die Selbstaufgabe. Er lehnt die medizinische Behandlung seiner Wunden ab. Das Leben würde nicht besser werden. Auf seinen Wunsch hin wird José seine körperlichen Spuren löschen und ihn im Bäckerofen verbrennen. Parallelen zum Tod eines Heilandes und dem Entrücken des Leichnams. Was er dem Rudel zurücklässt, ist die Kraft. Wo Freunde sind, ist kein Platz für Angst.
Ein nachdenklicher Roman, der durch unaufdringliche märchenhafte Passagen in einem für die Perzeption hilfreichen Gleichgewicht gehalten wird. Ein Roman des schwedischen Krimischriftstellers Mankell, der selbst ein Theater in Mosambik unterhält. Ein Theater, das sehen macht, das aber auch erlaubt die Augen zu verschließen. Und leider ist das Sein vor den Türen des Theaters immer noch so grausam, dass Mankell am Ende des Buches José die Worte in den Mund legt: „Ich weiß, dass ich Nelios Geschichte weitererzählen muss, selbst wenn es nur die Winde vom Meer sind, die hören, was ich zu sagen habe. Ich muss weiter von dieser Erde erzählen, die immer tiefer in ihrer Ohnmacht versinkt, wo die Menschen gezwungen sind, für das Vergessen zu leben und nicht für die Erinnerung.“ Note: 1/2 (ur)<<
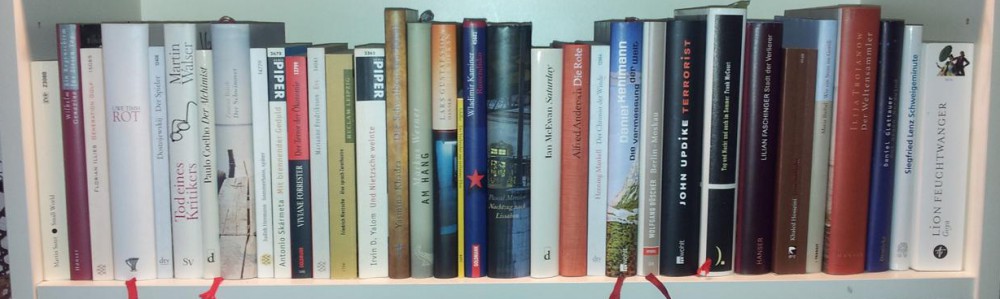
 Diogenes Taschenbücher 1974 (1960) – 235 Seiten
Diogenes Taschenbücher 1974 (1960) – 235 Seiten
 Goldmann Verlag 2000 – 192 Seiten
Goldmann Verlag 2000 – 192 Seiten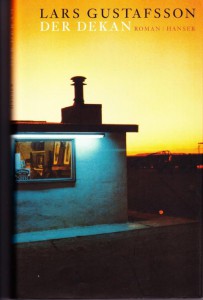

 Aufbau Verlag – 158 Seiten
Aufbau Verlag – 158 Seiten