Fischer Taschenbuch Verlag 2001 (1980) – 189 Seiten
>>Eva ist die Geschichte einer Frau, die sich entschlossen auf den Weg der Erkenntnis macht. Wo sind die Ursprünge von Schuld und Schuldbewusstsein, von Empathie und Ignoranz? Wo der Grenzbereich zwischen Natur und Kultur? Getrieben wird der Aufbruch von Evas Verzweiflung über den Brudermord unter ihren Kindern. Es ist auch ein Weg der Selbstfindung. Ein Weg durch eine bedrohliche Wildnis zu den Kindheitsursprüngen. Es wird ein Aufbruch mit zermürbenden Fragen um Schuldzuweisungen zu überwinden. Es ist auch die Tortur einer Schmerz befreienden Emanzipation.
Eingebettet ist diese seelisch-rationale Entwicklungsreise in das biblische Szenario der Vertreibung aus dem Paradies und folgenden Episoden der christlichen Urgeschichte. Nur dass viele Elemente der Bibel von der Autorin ins Gegenteil verkehrt werden. Die Frau ist nicht Ursprung der Schuld, sondern Anfang der geistigen Befreiung und damit der Menschwerdung. Das Paradies nicht paradiesisch, sondern satanisch-brutal. Der Mann nicht der Quell der Erkenntnis. Er ist nicht der Gemeinschaft-Gestaltende, sondern ein von Zank, Zweifel und Zaudern blockierter Egomane.
Den Ausgangspunkt des Plots stellt der Brudermord von Kain an Abel dar, der Eva als Mutter beider Söhne verzweifeln lässt. In der Erwartung, in ihrer eigenen Kindheit Antworten und Trost zu finden, macht Eva sich allein auf die gefährliche Wanderung zurück in die Region, in der sie groß geworden war. Auf Bäumen versteckt, beobachtet sie ihre alte Horde, in der alle Mitglieder ohne Identitätsbewusstsein wie in einem Einheitskörper leben. Terrorisiert von einem brutalen Anführer. Vergewaltigungen, koitale Orgien und das Fehlen jeder Achtung voreinander charakterisieren die Horde als animalische Herde. Den Hordenmenschen fehlt die Sprache und das Zeitgefühl. Sie leben ausschließlich im Hier und Jetzt. Haben keine Erinnerung an das Gestern und kennen deshalb auch keine Schuld für Getanes. Sie fürchten sich nicht vor der Zukunft und sind deshalb voller naivem Übermutes. Tod und Verlust sind ihnen unverständlich. Tote sind augenblicklich vergessen. In dieser Beobachtung findet Eva die tröstende Erklärung für das Naive im Brudermord. Offensichtlich trug Kain noch Züge dieses Urverhaltens in sich. Damit könne ihm kein Vorsatz unterstellt werden und über ihn kein Schuldspruch gefällt werden. Kain trage die satanischen Züge des Hordenführers in sich. Der Mann – das Tier – die Gewalt.
Entgegen den gängigen Verhaltensmustern hatte Evas Mutter ihre Tochter nicht der Horde überlassen. Heimlich brachte die Mutter Eva die nur von ihr beherrschte Sprache und ein darin vermitteltes Wissen bei. Auch die junge Eva wurde vergewaltigt. Sie war zu jung, um das neugeborene Mädchen zu stillen. Die Horde entsorgte darauf das tote Baby im Moor. Die traumatische Erfahrung wurde zum Ausgangspunkt eines verzweifelten Befreiungsversuchs und führte die Mutter und Eva zu einem Eremiten. Es sollte der Ort werden, an dem Eva dem Schamanenlehrling Adam begegnete. Eva und Adam setzten die Flucht gemeinsam fort und begannen ein neues, anderes Leben.
Auf dem Weg zurück von diesem Erkenntnispfad, wird Eva von Hirten gepflegt. Das Hirtenvolk verfügt über einen ähnlich fortgeschrittenen Entwicklungsgrad wie sie. Entsprechend kann die Menschwerdung des letzten Kapitels der Schöpfung nicht einmalig gewesen sein. Paradiese / Horden / Vertreibungen müssen sich hundertfach wiederholt haben. In Fredrikssons Neuschöpfung erscheinen Verweise auf einen himmlischen Gott vermehrt als Anklagen. Gott beschränke sich darauf, die Gläubigen bevorzugt in Seelennöte zu treiben.
Sprachlich bietet das Werk wenig. Evas Seelenreise rotiert zu häufig um die gleichen Wegmarken. Der Entwicklungsstrang fällt letztlich dürftig aus. Abgesehen vom ersten Drittel des Werkes mit den prinzipiellen Gedanken zur Menschwerdung durch das Erkennen von Zeit, ist diese Mitteilungsprosa eher der Trivialliteratur zuzuordnen. Der gesellschaftliche Impetus der nachinterpretierten Frauenemanzipation glättet diese Wogen nicht. Note: 3/4 (ur)<<


 Collection S Fischer, 1998 |188 Seiten
Collection S Fischer, 1998 |188 Seiten
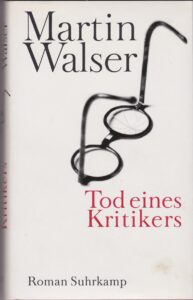 Suhrkamp Verlag 2002 – 219 Seiten
Suhrkamp Verlag 2002 – 219 Seiten Kiepenheuer & Witsch,
Kiepenheuer & Witsch,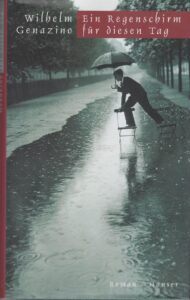 Hanser Verlag, 2001 | 173 Seiten
Hanser Verlag, 2001 | 173 Seiten