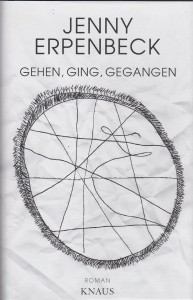>> In the end, we will remember not the words of our enemies, but the silence of our friends –
zitiert die Autorin einleitend Martin Luther King. Und tatsächlich ist der Tenor ihres Werkes eine anklagende bundesrepublikanische Innenschau, die neben lauten Grausamkeiten in den Heimatländern afrikanischer Flüchtlinge vor allem eine anteilnahmslose Lautlosigkeit im deutschen Bekanntenkreis auszumachen glaubt. Die Gegenüberstellung verortet sie vor dem Roten Rathaus in Berlin. Flüchtlinge haben sich den Mund zugenäht und verweigern ihre Namen und die Nahrungsaufnahme, um mit diesem Weniger politisch mehr zu werden. Richard, der Protagonist des Romans, liest: We become visible. Erpenbeck lässt Richard zunehmend tiefer in die Abgründe schauen und kommt zu dem Schluss, dass sich dieses, sein Land nicht sehen lassen kann. Die offizielle Willkommenskultur sei nicht mehr als eine zur Willkür-verkommende Unkultur.
So unerfahren wie Richard als emeritierter Professor der Altphilologie in seinen jüngst verordneten Ruhestand tritt, so unbeholfen betritt er den Berliner Alltag der Dritten Welt. Irgendetwas macht ihn neugierig – vielleicht der Forscher in ihm, dessen Fragen nach dem Lieblingsversteck und dem Besitz eines Haustieres in der Kindheit dieser Afrikaner allerdings unbeantwortet bleiben. Stattdessen bekommt er Antworten auf nicht-gestellte Fragen, erfährt von Versklavung in Nigeria, Vertreibung aus dem libyschen Exil, Opferzahlen auf dem Mittelmeer, Willkür in italienischen Lagern und zivilisierter Behördentyrannei in Deutschland. Nach und nach werden ihm Asylrechtsverordnung, Aufenthaltstitel und Rückführung inhaltsdrohende Begriffe. Nach und nach wird Richard zum täglichen Besucher, der sich beim Eintritt in das Asylbewerberheim schon nicht mehr ausweisen muss. Nach und nach werden ihm Schwarzafrikaner, deren fremdländische Namen er zunächst durch altgriechisches Tristan, Apoll und Jupiter ersetzt, zu Osarobo, Yussuf und Raschid. Richard wird zu ihrem Schatten und schließlich zu ihrem Licht, das die Wege durch Polizeireviere, Amtsstuben und Rechtsanwaltspraxen ausleuchtet.
Richard kauft für ein paar tausend Euro spontan ein unbekanntes Grundstück in Ghana, damit die Eltern eines Flüchtlings die Familie versorgen können. Richard lehrt Klavier spielen. Richard quartiert in seinem Haus ein Dutzend Flüchtlinge ein. Richard lässt sogar Freunde konvertieren. Die Gründe scheinen ihm überzeugend: Ein Flüchtling verschwindet aus dem Operationssaal der Charité, weil ihm die sofortige Hilfe für Freunde wichtiger ist als seine Herzoperation. Ein Flüchtling würde selbst dann eine deutsche Frau nicht heiraten, wenn Sie ihn zutiefst liebt, weil man meinen könnte, er heirate nur um eine Aufenthaltsgenehmigung zu erwirken. Diese aufrichtigen Moralvorstellungen inszeniert die Autorin als Gegenentwurf zu Richard, der zwar altruistisch bemüht aber moralisch labil angelegt ist. Er hatte nicht nur eine langjährige Freundin während der Ehe mit seiner verstorbenen Frau, sondern fantasiert schon wieder von der anmutigen äthiopischen Lehrerin, die in akzentfreiem Deutsch Sprachunterricht erteilt.
Während deutsche Behörden durch Wortklauberei Demonstrationsrechte langatmig behindern, gelingt einer afrikanischen Magierin in Berlin durch Versenken von Richards Bargeld in einem dampfenden Bodenloch die Direktüberweisung nach Ghana innerhalb weniger Stunden. Ebenso lässt die Schriftstellerin Richard erleben, wie das deutsche Gesundheitssystem dem traumatisierten Rufu durch Psychopharmaka fast das Leben nimmt, obwohl seine Niedergeschlagenheit von einem vereiterten Zahn herrührt.
Mit dem Blick auf einen Tisch im Männerwohnheim, in das Tristan abkommandiert wird, vollzieht Erpenbeck schließlich den unmittelbaren Kulturvergleich. Während die anderen Zimmerbewohner (Zitat: „süchtige, wahnsinnige und sehr arme Deutsche“) mit Essensresten und Flaschen die einzige Ablage versauen, lebt der schwarzafrikanische Gast Kultur vor: Zitat: „Richard … sieht das Drittel vom Tisch, das Tristans Parzelle ist: leer und sauber gewischt“ S.332). Prägnanter lassen sich zwei Kulturprofile kaum gegenüberstellen. Jene Lesenden, die sich bis hierher durch Erpenbecks Text träumten, werden sich spätestens an dieser Tischkante stoßen. Gehen, ging, gegangen versteht die Autorin als Unterricht gegen „blondgescheiteltes“ Deutsch, das Symbol inhumaner Flüchtlingspolitik. Mit Gehen, ging, gegangen konjugiert sie bundesrepublikanische Gefühlskälte, die das Land mit Bodenfrost überzieht. Wie kalt ist es wirklich und ist es nur das? LeserInnen beginnen zu frösteln.
Dabei ist die Anlage des Romans vielversprechend: Erhellende Begegnungen in der Not. Menschen aus verschiedenen Kulturen, denen gemeinsam ist, dass sie unter Verlusten leiden. Auf der einen Seite Schwarzafrikaner, die ihre Angehörigen und ihre Heimat verloren. Auf der anderen Seite jener Professor, der seine Frau und seinen Lebensinhalt durch die Pensionierung verlor. Dazwischen die deutsche Wirklichkeit. Schließlich die literarische Idee, eine Umkehrung des Lernprozesses zum Leitmotiv zu machen. Durch das sehr unterschiedliche Gewicht der Verluste auf beiden Seiten wird der Sprachunterricht für Ausländer zur Nebensache. Stattdessen macht Erpenbeck Gehen, ging, gegangen zu Lehrstunden für Richard. Leider bricht hier jedoch die literarische Raffinesse ab, da es Erpenbeck nicht gelingt, Richards Lernprozess mit Leben zu füllen. Welchen Einfluss hat die unerwartete Begegnung mit fremden Verlusten auf die Verarbeitung der eigenen Verluste? Sind es gerade die Kulturunterschiede, die in diesen Krisen neue Sichtweisen ermöglichen? Wir erfahren es nicht. Stattdessen benutzt die Schriftstellerin den Hauptdarsteller Richard lediglich als verblasten Spiegel, durch den sie der Leserschaft Migrationsdetails vorführt. Leider entwertet sie nachhaltig ihre mitunter interessanten Interkalationen, wenn z.B. verschiedene Flüchtlingsereignisse sprachlich mit verschiedenen Stadien des Klavierunterrichts verflochten werden (S. 292). Letztlich aber bleibt der Roman als große Literatur viel zu dünn, und ist als Sachbuch nicht dick genug.
Entsprechend wird die Leserschaft mit einer dumpfen Einseitigkeit entlassen, so dass von Martin Luther King kaum mehr übrigbleibt als:
In the end, we will remember not the words
Schade. Das Werk hätte so viel mehr sagen können. Note: 3/4 (ur) <<
>> Was gut gemeint ist, kann auch völlig misslingen. Erpenbecks Roman ist der Beleg. Da geht der seit kurzem emeritierte Professor für Klassische Philologie an der Humboldt Universität über den Berliner Oranienplatz, ein Platz, der ihn an Hugenottische Flüchtlingsgeschichte und an Lennés großartigen Gartenbauplan aus dem vorletzten Jahrhundert erinnert. Noch nimmt er die Gruppe „Schwarzer“, („Schwarz- häutiger“, „Schwarzer Männer“ ) mit „weißen Sympathisanten“ nicht wahr , die mit Campingtisch und Schlafsack und einer „weißgestrichenen Pappe“ in „schwarzen Buchstaben“ mit der Aufschrift „Wir werden sichtbar“ lieber sterben wollen als sagen, wer sie sind. Vielmehr erfahren wir von Richards beginnender Einsamkeit. Zunächst von der Geliebten betrogen und verlassen, dann die Ehefrau verloren („getrunken hatte sie auch, aber das ist eine andere Geschichte“ dann Frau Erpenbeck bitte weglassen) dann noch ein Toter im nahegelegen See, da ist es doch mehr als verständlich, dass „die Zeit jetzt eine andere Art von Zeit ist“, dass ihn „die Zeit an sich quält“. Dass wir als Leser dann allerdings mit Richards Einkaufzettel, Rasenmähen, Pfingstrosenplanzung, Erbseneintopf, abendlichen Wurstbroten, Reparaturarbeiten am Gartenhäuschen und seinen Schlafproblemen „nachts geht er pinkeln und kann danach nicht mehr einschlafen“ gequält werden, geht zu weit. Wie gut, dass Richard auch regelmäßig Zeitung liest und Nachrichten schaut. So wird dem Herrn Professor nicht nur allmählich klar, wie die Hauptstäde afrikanischer Staaten heißen, sondern auch, dass sich auf dem Berliner Oranienplatz und vor dem Berliner Rathaus etwas abspielt, dem er sich nicht entziehen kann: eine afrikanische Flüchtlingsgeschichte. Aus der Konfrontation mit der Realität entsteht Richards Projekt eines zunehmend verkitschten privaten Hilfsprogramm, das seinen Höhe- und literarisch zugleich seinen Tiefpunkt am Schluss in Richards Geburtstagsfeier findet, bei der sich zwei Kulturen friedlich und freudig vereint in Richards Haus – jetzt sogar eine „anerkannte Heimunterkunft“ – zusammenfinden. Doch kurz der Reihe nach. Richard ist schließlich keine Sponti, sondern Professor. Da will alles gut vorbereitet sein. Also zunächst Buchrecherche „zum Thema“ (das steht tatsächlich so da auf S.51 –hanebüchen!!!!!) und „einen Fragenkatalog… entwerfen“ (das steht tatsächlich auch so da) für Interviews mit den Flüchtlingen. Und da es wichtig ist, die „richtigen Fragen“ zu stellen, lesen wir unter anderem folgendes: „Was war in ihrer Kindheit ihr Lieblingsversteck“, „Was für Kleidung trugen sie“, „Wie haben sich ihre Eltern kennengelernt“ und als besonders sensible Schlussfrage „Wo soll man sie begraben“. Was Richard in den folgenden Tagen im Flüchtlingsheim an Einzelschicksalen vor allem aus dem Munde von Awad aus Ghana, Raschid und Zair aus Nigeria, „Apoll“ aus Mali, später von Osarobo aus Niger erfährt, ist eine Mischung von tragischen Schicksalen, politisch-religiösen Verwerfungen und Idyllisierung vom einfachen afrikanischen Leben (Tuareg-Geschichte). So fühlt sich auch der „emeritierte Professor“, der „hier an einem Tag so vieles zum ersten Mal hört, als sei er noch einmal ein Kind“ sichtlich ergriffen. Doch neben dieser Infantilisierung gibt es auch Erkenntnisgewinn. Richard hat nicht nur Hegel und Nietzche gelesen „aber was man essen soll, wenn man kein Geld hat“, das „weiß er auch nicht“. Jedenfalls gelingt Richard noch der Transfer klassischer Bildung mit seinen ihm zunehmend an Herz gewachsenen afrikanischen Flüchtlingen. Schon der „Schwarze“ mit den goldenen Turnschuhen am Oranienplatz wird für ihn zu „Hermes“, statt sich die „fremden Namen der Afrikaner zu merken“ mutiert Awad aus Ghana zu „Tristan“ (durch Richard wird selbst Gottfried von Straßburg noch aktuell) und Raschid, als 13jähriger aus Nigeria geflohen, nachdem der Vater von 24 Kindern und 5 Frauen (merkwürdig, der ist doch Christ) und jetzt wichtiger Ansprechpartner und Organisator seiner afrikanischen Flüchtlingsfreunde zum „Olympier“ und „Blitzeschleuderer“. Was folgt ist überwiegend eine – ich weiß, das Bild ist hier gewöhnungsbedürftig – Schwarz-Weiß-Zeichnung: hier die bedauernswerten Flüchtlinge, dort die kaltherzige deutsche Bürokratie. Während Richards Engagement von Seite zu Seite steigt, er gibt Sprachunterricht für Fortgeschrittene, während die schöne Äthiopierin ( Richard, der klassische Männerphantasien entwickelt, unterstellt ihr durch ihre Tätigkeit „einen schwarzen Mann zu wollen“) um sprachlichen Basics bemüht, er vermittelt den Krankenpfleger Ali für Annas Mutter, Osarobo aus Niger – dessen Schicksal Richard an Mozarts Tamino erinnert (!!) darf zum ersten Mal in seinem Leben ans Klavier, ein dünner Mann mit Besen aus Ghana, Karon Anubo, erhält von Richard 3000 € für den Kauf eines Stück Lands, das seiner Familie wieder eine Lebensperspektive gibt – voodohaft die Form der Geldtransaktion in einem Berliner Hinterzimmer und zugleich Richards naive Faszination wie einfach ist doch der Grundstückserwerb in Ghana gegenüber der komplizierten Vertrags- und Rechtskonstruktion in Deutschland sei-, er begleitet Flüchtlinge bei Behördengängen zu durchweg kaltherzigen Berliner Beamten der Ausländerbehörde oder Ihtemba zum verständnisvollen und doch etwas skurrilen Altachtundsechzigeranwalt und Tacituskenner, der auf „Germania“ verweisend zur reichlich abstrusen These belangt: „Vor 2000 Jahren waren die Germanen das gastfreundlichste Volk, das es gab.“, um eine Seite später zum vernichtenden Urteil über unseren heutigen Rechtsstaat zu kommen „Jetzt, 2000 Jahre später, gibt es den Paragraphen 23, Absatz 1, Aufenthaltsgesetz“. Nur ein einziges Mal scheint Richard mit seinem Goodwill-Programm ins Schlingern zu kommen. Er weint, „wie er seit dem Tod seiner Frau nie mehr geweint hat“, nachdem er sich von Osarobo hintergangen glaubt. Doch Richard kommt wieder ins Lot, weil der Einbruch und sein möglicher Täter durch diffuse religiöse SMS-Botschaften Osarobos im Nebulösen bleibt. Stolz kann Richard allerdings auf seinen vorwiegend akademischen Freundeskreis sein, der über viele viele Seiten hinweg seinem Kampf gegen die Ungerechtigkeit Berliner Flüchtlingspolitik und seiner Empathie für die Probleme der „schwarzen Männer“ eher verständnislos und vorurteilsbesetzt (das Detlef-Sylvia-Päarchen, der Peter-Archäologe mit seinem 21jährigen Freundin-Naivchen Marie – die Afrikaner bringen doch nur Typhus und AIDS) begegnet. Als dann allerdings nach der vom Berlinder Senat verfügten Räumung der Flüchtlingsunterkunft in Spandau die Obdachlosigkeit droht, stehen Richard und seine Freunde wie eine Eins solidarisch mit den gedemütigten Afrikanern: bereitwillig öffnen sich Professoren- und Bürgerhäuser und selbst Naivchen Marie bietet in ihrer WG ein Zimmerchen an. Hier gelingt Richard im Freundeskreis ohne Worte schlicht durch die faktische Notsituation ein Gesinnungswandel , der mir als Leser bis zum Ende des Buches vorenthalten bleibt. Oberpeinlich bleibt nur noch der Schluss, als Detlefs Bemerkung über die Krankheit seiner Frau Sylvia unter allen Anwesenden (Sprachbarrieren der Afrikaner scheinen völlig aufgehoben) in der noblen Flüchtlingsherberge Richards ein kollektives stilles Gedenken an einstmals geliebte Frauen auslöst und als wäre dies alles nicht schon genug, wird auch noch eine frühe Abtreibungsgeschichte Richards mit Khalids gefährlicher Mittelmeerüberfahrt verknüpft um in pseudophilosophischen Sentenzen völlig zu versinken.
Übrigens: „Den lachenden Yussuf aus Mali, einen kleinen kohlrabenschwarzen Mann“ (S.155) oder Rufu aus Burkino Faso „Rufu ist jedenfalls sehr schwarz“ (S.163) wird die Präzisierung sehr freuen! Note: 5 – (ai) <<
<< Der Schutzumschlag: Weiß-Schwarz. Das Coverbild innen: Schwarz – Weiß. Kein gutes Omen. Denn auch der Inhalt ist allzu holzschnittartig Schwarz – Weiß geraten:
Auf der einen Seite die Flüchtlinge, einfühlsam, mit afrikanischem Migrations-hintergrund, in dem die stolzen Tuareg keinen Kompass brauchen um sich zu orientieren und in dem Grundstücksgeschäfte in Ghana gänzlich ohne diesen ganzen westlichen Papierkram binnen Stunden zustande kommen. Richard, ein emeritierter Professor für alte Geschichte, macht sich etwas unvermittelt auf, sich für diese Menschen aus Libyen, Niger, Ghana, Burkina Faso, zu engagieren und sich für ihr Schicksal zu interessieren. Auf der anderen Seite die unbarmherzige deutsche Bürokratie, die eine illegale Zelt- Siedlung auf dem Oranien-Platz und die Besetzung einer Schule in Kreuzberg einfach nach Monaten der Duldung auflösen will, und die mit Vorurteilen beladenen Freunde von Richard wie Detlev und Sylvia, „ die vielleicht nicht einmal wissen, wo Niger liegt“. Dabei weiß Richard selbst nicht, was Tuareg sind, was ein Aufenthaltstitel und was Dublin II ist. Dies soll wohl den etwas weltabgewandten Wissenschaftler charakterisieren.
Die Geschichte bewegt sich immer wieder mal auf den Rand zum Flüchtlingskitsch zu. Das ist besonders ärgerlich, da es die schrecklichen Schicksale der aus Elend, Armut, Korruption und Gewalt fliehenden Menschen zwangsweise mit ins Seichte, Unglaubhafte zieht. Unerträglich wird es im letzten Kapitel, als Richard in seinem Haus quasi ein privates Flüchtlingsheim etabliert und bei einer Gartenparty, auf dem das Fleisch natürlich halal ist, Richards Freund Detlev erzählt, dass seine Frau schwer erkrankt ist. Die geschilderte Empathiewelle, die sich nun in den Köpfen der Flüchtlinge aufbaut, ist völlig missraten. „Alle miteinander denken einen Moment lang an Frauen, die sie geliebt haben und von denen sie einmal geliebt wurden.“
Leider gibt es auch einiges an unmotivierten Wiederholungen und schiefen Sprachbildern, (Der „Volksmund“ schreibt nicht in Internetforen! (S.226) ) so dass das Buch auch sprachlich nicht überzeugt.
Warum es dieses Buch bis in die shortlist zum Deutschen Buchpreis 2015 geschafft hat, bleibt rätselhaft. Wer wirklich etwas Tiefgründiges erfahren will über die Flucht eines jungen Gambiers nach Deutschland und seine Sicht auf unser Land, dem sei das Essay „Modou und die Frauen“ von KHUE PHAM in der ZEIT N° 51 empfohlen. Note: 4/5 (ün)
<< Wie oft steht man vor einem Problem und weiß nicht, was Sache ist. Emeritus Richard weiß zum Beispiel nicht, wie es den afrikanischen Asylanten tatsächlich geht. Was liegt da näher, als einen Fragebogen zu verfassen und sich damit in deren Unterkunft zu begeben. Die Fragen haben es in sich, ich möchte sie trotzdem nicht wiederholen.
Richards Spezialgebiet ist der „griechische Götterhimmel“. Deswegen nennt er die Neuankömmlinge Apoll, Blitzeschleuderer und schöner. Auch wenn eine große Hilfsbereitschaft gegenüber den Flüchtlingen in Deutschland besteht, nicht alles läuft rund und man kann manches kritisieren.Trotzdem scheint es mir nicht angemessen, dass die Autorin mehrmals die wohlbekannte NS-Keule bemüht: „Nur wenn sie Deutschland jetzt überlebten, hatte Hitler den Krieg wirklich verloren“. (Seite 64)
Oder wenn ein Bustransport mit dem Abtransport ins KZ verglichen wird (Seite 259). Über das Leben in Deutschland: „Sie sind vor dem Krieg geflüchtet und der Krieg hält an.“
Und die Deutschen selbst? Sie „verteidigen ihr Revier mit Paragraphen, mit der Wunderwaffe der Zeit hacken sie auf die Ankömmlinge ein, stechen ihnen mit Tagen und Wochen die Augen aus, wälzen die Monate über sie hin, und wenn sie dann noch immer nicht still sind, geben sie ihnen, vielleicht, drei Töpfe in verschiedenen Größen, einen Satz Bettwäsche und ein Papier, auf dem Fiktionsbescheinung steht.“ Diese Deutschen mit ihren Wunderwaffen…. Entschuldigung für den langen Satz, ich kann ihn nicht kürzen.
Solche Sätze gehen, gingen, sind mir auf den Geist gegangen.Schade, dass ein wichtiges und viele Menschen bewegendes Thema vergeigt wurde.
Der Roman war absoluter Favorit für den Deutschen Buchpreis 2015. Ich habe keine Rezension gefunden, in der das Buch nicht über den grünen Klee gelobt worden wäre. Woran könnte das liegen? Liegen nur ein paar Tübinger daneben? Sollte ich das Buch nochmals lesen? Note:4 – (ax)<<