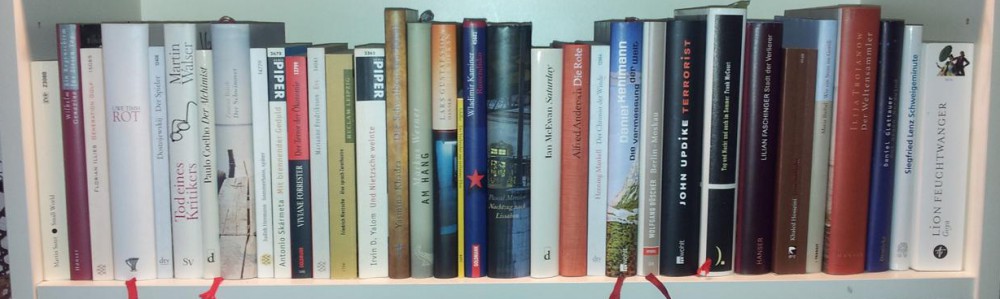Diogenes 1995 – 207 Seiten
>>Ein ungewöhnlicher, deutscher Roman, in dem eine kognitive Schwäche eine ordnungsversessene Frau zu einer SS-Mörderin werden läßt und ein Schulbub lebenslänglich die Kraft zu lieben einbüßt, weil er eben diese Frau liebte. Der Roman thematisiert die Absurdität des menschlichen Seins, in der die Scham als Analphabetin enttarnt zu werden schmerzlicher empfunden wird als die moralische Last, Hunderte von Juden umgebracht zu haben. Und es ist das Thema dieses Werks, dass eine zutiefst enttäuschte Initialliebe zu einer lebenslangen Bindungsunfähigkeit führt und damit jede weitere Enttäuschung, die aus erneutem Verlassen werden erwachsen könnte, schon im Vorfeld unterbunden wird.
Kindheit. Der 15-jährige Michael Berg erbricht sich auf der Straße und wird von der unbekannten Hanna Schmitz (36) versorgt. Es entwickelt sich eine Bekanntschaft, die schnell in eine ungleiche Beziehung mit stets gleichem Ritual übergeht: Michael liest Geschichten vor, beide baden, sie schlafen miteinander. Das von H. verordnete obligatorische Bad wirkt wie ein Reinheitszeremoniell – vielleicht eine zwanghafte Prinzipienhandlung, vielleicht aber auch eine äußerliche Ersatzhandlung für eine innerlich nicht vollzogene Moralreinigung mit Blick auf das persönliche Kriegsverbrechen.
Die folgenden Monate sehen Auseinandersetzungen und Zurückweisung durch eine unberechenbare H. und die kindliche Unterordnung eines Michael. Die Initiationsliebe, die der völlig unbedarfte Junge erlebt, gräbt unverwüstliche Spuren in sein Seelenleben. Er wird sie ein Leben lang lieben. H´s Gefühle bewegen sich im Verborgenenen – vermutlich ist auch sie gebieterisch ihrem „Jungchen“ verfallen. Sie: Straßenbahnschaffnerin. Er: Schüler und Erfinder einer 4-tägigen Fahrradtour. Sie: Aus Verlassenheitsangst einen Ledergürtel in sein Gesicht schlagend. Er: Seiner Schwester Kaufhausklamotten klauend, damit sie ihm die Wohnung allein mit H. überläßt. Sie: Kontrollgänge ins Schwimmbad, ob Michael sich anderen Mädchen nähert. Dann H´s kommentarloses Verschwinden für immer. Er: ein Leben lang Geschädigter, der sich nie wieder auf eine Frau wird verbindlich einlassen können.
Studienzeit. Michael reift zu einem verschlossenen Jurastudenten heran, nimmt an KZ-Prozessen teil und begegnet auf diesem Wege unerwartet H. . Sie wird zu lebenslanger Haft als KZ-Aufseherin verurteilt, die 300 Frauen in eine brennende Kirche einsperrte und deren Tod veranlasste. H. pocht noch nicht einmal auf einen Befehlsnotstand, sondern zitiert in bizzar naiver Weise Ordnungsprinzipien, denen sie in jedem anderen politischen Zusammenhang vermutlich ebenso gefolgt wäre. Die Prozessatmosphäre ist gekennzeichnet durch eine metale Betäubung als gemeinsamer Zustand von Opfern, Tätern und Richtern. Auch Michael verharrt in diesem Zustand – selbst nach einem KZ Besuch vermag Michael keinen emotionalen Bezug zu den Gräueltaten herzustellen.
Ein fatales Motiv begleitet H´s Lebensentwicklung, nämlich die schambesetzte Flucht vor ihrem akribisch verborgen gehaltenen Analphabetismus. Diese Scham begründet eine Vielzahl von Fehlentscheidungen: um der Entdeckung durch den Arbeitgeber Siemens zu entgehen, kündigt sie ihre erste Anstellung und wird KZ-Aufseherin; weil sie einen Zettel von Michael nicht lesen kann; schlägt sie ihn; um der Beförderung von der Straßenbahnschaffnerin zur Büromitarbeiterin zu entgehen, verschwindet sie spurlos – auch aus Michaels Leben. Um sich beim KZ-Prozess bei einer Schreibprobe nicht entblößen zu müssen, stellt sie sich freiwillig als Verfasserin eines KZ-Dokumentes dar, was ihr eine lebenslange Haft, ihren leugnenden Mitangeklagten jedoch nur begrenzte Gefängnisstrafen einbringt. Michael entdeckt die Hintergründe und ringt mit sich, die mildernden Umstände dem Gericht mitzuteilen. Der Rat seines Vaters, selbst Professor der Philosphie, jedoch lautet, davon Abstand zu nehmen, da Würde mehr bedeute als Glück. Die Verletzung H´s Scham würde schwerer wiegen als die Freiheit, die sie durch verminderte Schuld erhalten würde.
Zweite Lebenshälfte. Michaels Gegenwart zerfällt: die Ehe, die Familie, die Feunde. Er flüchtet in die Kreisbewegung der Rechtsgeschichte: immer wieder von vorn beginnen, immer wieder suchen. Das Motiv der Odyssee, die er H. vorlas, wird zum Lebensinhalt. Innerlich kehrt er zu Hanna zurück ohne ihr jedoch direkt gegenüberzutreten. Über 10 Jahre hinweg schickt er H. von ihm besprochene Kassetten, denn das Vorlesen von Werken aller Art war es, was sie zutiefst berührte. Zum Zeitpunkt ihrer Entlassung nach 18 Jahren findet Michael ihr Wohnung und Arbeit, die sie jedoch nie nutzen wird. Man findet sie in der Zelle erhängt. Hat sie sich gewandelt? Lesen – auch als Akt der Selbstbestimmung und Erkenntnis – hatte sie sich anhand der Kassetten selbst beigebracht. Ihre nächtlichen Träume hatten sich zu von den Opfern überrannte Alpträume verdichtet. Nachdem für sie Reue Jahrzehnte eine unbekannte Größe war, scheint sie zum Ende hin Schuld-offen. Aber ist der selbst vollstreckte Tod tatsächlich ein Schuldbekenntnis den Opfern gegenüber? Michael gegenüber? Oder ist der Grund das Nicht-mehr-erreichen-können ihrer vermuteten Liebe, dem Jungchen, das vielleicht auch die unüberbrückbare Scham spürt, mit einer Massenmörderin vertraut gewesen zu sein?
Am Ende versucht Michael in New York H´ s Erspartes, das sie ihm vermachte, der einzigen KZ-Überlebenden zu überbringen. Doch das Opfer verweigert die Annahme. Weder H. noch ihm wird eine Sühnegelegenheit gegeben. Erst im Schreiben findet er seinen Frieden. Es ist die Schrift dieses Werks.
Eine feinfühlige Geschichte mit ungewöhnlicher Verknüpfung von Schuld, Geschichte, Liebe und Scham in einer glasklaren Sprache, direkt und schnörkellos. Lesenswert. Note: 2+ (ur)<<